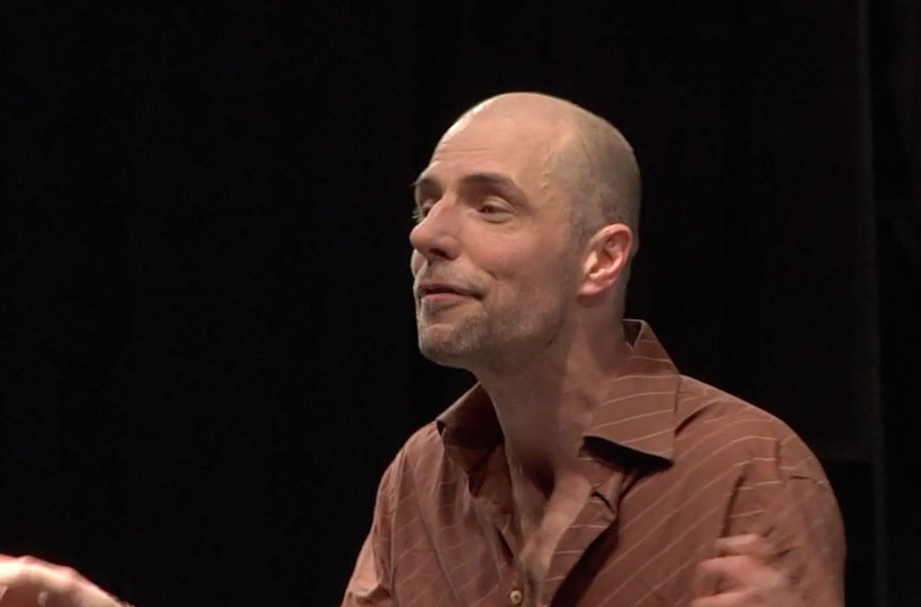TheorieTheater mit Borkman (Teil I – praktisch)
Martina Leeker, März 2015
Überblick. Theorietheater mit Borkman
Bei dem Stück “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen. Einige wissenschafts-performative Erwägungen, sehr frei nach Ibsen, Bataille, Reckwitz und Bröckling” handelt es sich um ein Theorietheater. Es kam 2014 in Hamburg in der Regie von Martina Leeker zur Aufführung. Es spielten die Laiendarsteller_innen: Sven Asmus, Nick Doormann, Monika Kuhrau-Pfundner, Susanne Lange, Constanze Schmidt, Nicole Seiler, Agnes Stangenberg. Grundlage war das Stück John Gabriel Borkman von Henrik Ibsen aus dem Jahr 1896. Dieses handelt vom gleichnamigen Bankier, der Gelder seiner Bankkunden veruntreute und nach verbüßter Gefängnisstrafe von einem Comeback träumt. Im Verlauf des Stückes buhlen Borkman, seine Frau Gunhild sowie deren Zwillingsschwester Ella Rentheim, einst Borkmans Geliebte, aus unterschiedlichen Gründen um die Gunst des Borkmanschen Sohnes Erhart. Als Ella auf dem Gut eintrifft, um Erhart zur Sterbebegleitung zu sich zu holen, kommt es zum Showdown der Figuren, an dessen Ende Borkman stirbt.
Im Stück “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” sollte Borkman erstens ob seiner ins Leere laufenden und vom Wahn bestimmten Profitgier als anti-kapitalistischer Helden entworfen und erprobt werden. Es ging zweitens darum, spielend zu erkunden, ob die Existenz einer neoliberalen Ordnung schon ausgemacht und deren theoretische Erfassung immer schlüssig sei. Um die beiden Fragen zu bearbeiten, sollten theoretische Texte zum neoliberalen Kapitalismus, vor allem von Ulrich Bröckling zum “Unternehmerischen Selbst” und von Andreas Reckwitz zum zur ästhetischen Selbstausbeutung zwingenden “Kreativitätsdispositiv“, mit Spielszenen aus Ibsens Borkman in Form eines bezogen auf das Anliegen der Inszenierung illustrierenden Beweisverfahrens konfrontiert werden.
In diesem Anliegen ist die Zuordnung des Projektes zum Unterpunkt “Organisation” der Webpublikation “Experiments&Interventions. Diskursanalytische Ästhetiken als Methode für digitale Kulturen” begründet. Denn in diesem Unterpunkt geht es um die Intervention in Organisation und Organisationen/Institutionen, denen eine neoliberale Ordnung nachgesagt wird und deren Reflexion. Eine entsprechende Auseinandersetzung wurde im Theorietheater unternommen.
Im theorietheatralen Experiment kam es nun allerdings zu einer bemerkenswerten Wende. Denn die theoretischen Verhandlungen wurden vom Performativen überrollt, das die Komplexität der Verkörperung, das Unvorhersehbare des Vollzugs von Handlungen sowie eine Eigenlogik des Spiels einbrachte. In der Verkörperung der Frage, ob und inwiefern Borkman als anti-kapitalistischer Held gelten könne, wurde vor allem die Ausrufung einer ubiquitären neoliberalen Ordnung und Ökonomie zweifelhaft, die im geisteswissenschaftlichen Diskurs derzeit kritiklos als einzig angemessene Theorie angesehen wird. Im spielerischen Umgang wurden mithin die Theorien zum neoliberalen Kapitalismus und zu dessen Subjektivierung und Gouvernementalität durch Selbst-Kontrolle und Selbst-Ausbeutung unterminiert.
Die entstandenen Einspielungen können versuchsweise zu einer Theorie der Ökonomie der Verausgabung und Verschwendung in digitalen Kulturen ausbuchstabiert werden. In dieser steht neben einer Ökonomie der Wertschöpfung und Nützlichkeit eine der bloßen Vergeudung und des unproduktiven Verlustes, die sich selbst genügen. An die Stelle eines sich zwar ausbeutenden, aber doch immer noch präsenten Selbst, das die neoliberale Ordnung ausagieren soll, traten selbst-lose Chiffren von Figurenmustern, die sich allein im Spiel gefielen. Die Widerstandsfigur Borkman avancierte zu einer sich in Im-/Potenzierungen perpetuierenden Illusionierung des Selbst. “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” wurde so zu einer Metapher, die auch als Kaleidoskop für Existenz in digitalen Kulturen gelesen werden kann. Folgt man der Inszenierung als Metapher des Digitalen, so konstituiert sich diese Kultur aus Aufführungen von Selbst-losen auf der Bühne sich selbst organisierender Infrastrukturen und Datentransfers. Auf dieser Bühne wird die neoliberale, an Wachstum und Profit orientierte Ökonomie an einer der Fülle und Verschwendung, zumindest von Daten, Affekten und Performances zerrieben.
Theorietheater würde somit zu einer methodischen Option für wissenschaftliches Arbeiten und Forschen. Denn es ging nicht mehr nur um eine Auseinandersetzung mit theoretischen Kontexten. Vielmehr wurden im Performativen eigene theoretische Versatzstücke hervorgebracht.
„Der Neoliberalismus mit seinem Zwang, die Bildung dem Diktat der Verwertbarkeit zu unterwerfen, offenbart sich unter anderem in der gewollten Flexibilisierung der Absolvent_innen. Hochschulen nehmen den Studienfächern flächendeckend Fachinhalte und ersetzen sie zum Teil durch allgemeinbildende Angebote, oder durch Lehrveranstaltungen zur Schulung der sogenannten Soft Skills. Die Universität Lüneburg, welche seit 2006 unter dem Markennamen ‚Leuphana’ firmiert, hat ihr ganzes Studienmodell nach diesem Prinzip aufgebaut.“ (Thorben Peters, Kevin Kunze, “Leuphana” als Symptom neoliberaler Hochschulpolitik 2015).
Allerdings war der Bezug auf die Leuphana Universität im Theaterprojekt nur ein Vehikel für die Erzeugung eines gemeinsamen „Dritten“, das eine übergreifende Entwicklung einspielte; und nicht etwa eine Auseinandersetzung mit der Universität selbst. Die Ansprache der Mitarbeiter_innen wurde in diesem „dritten Raum“ dadurch hergestellt, dass die Studierenden exemplarisch für ein Leben in neoliberalen Verhältnisse über ihre eigenen Befindlichkeiten sprachen. Ein weiterer (2) Aspekt der über die Leuphana und den Innovations-Inkubator exemplarisch eingespielten Themen digitaler Kulturen und neoliberaler Ökonomie sind Vernetzung und Netzwerke, die von sozialen, über ökonomische bis zu wirtschaftlichen Bündnissen reichen können. Dieser Aspekt wurde aufgerufen durch eine Szene im Format der „TheorieTheaters“, die zwei Studentinnen (Sarah Kresse, Lea Meinersdorf) angeregt von einem unveröffentlichten TheorieTheaterstück (Martina Leeker) erarbeiteten. In diesem Format werden theoretische Texte zu einer Szene zusammengefügt und inszeniert. Schließlich wurde (3) der Bezug zu digitalen Kulturen durch ein „Embodiment of remix“ erprobt. Remix (Felix Stalder, Neun Thesen zur Remix-Kultur 2009) ist eine Metamethode digitaler Kulturen, das heißt, sie wird in unterschiedlichen Bereichen wie Musik, Literatur oder Film genutzt, um, ermöglicht durch die technischen Möglichkeiten digitaler Codierung, bereits Vorhandenes durch Manipulationen auf der materiellen, datentechnischen Ebene neu zu kombinieren und zu etwas Eigenem zu synthetisieren. Damit wird zugleich eine Grauzone aufgemacht, denn Copyright oder wissenschaftliche Standardisierungen regulieren das Remixing. In den darstellenden Künsten ist das Remix nicht nur wegen der fehlenden digitalen Möglichkeiten im Spiel der Körper noch nicht angekommen. Vielmehr scheinen Körper und existente, fremde Werke anderer Darstellender im Kontext digitalen Remixens noch für Besitz, Authentizität und Subjektivität zu stehen. Indem im Theaterprojekt u. a. Choreografien von Pina Bauschs Kontakthof von 1978 für einen Remix entwendet wurden, sollte der Bezug zu digitalen Kulturen hergestellt und in der Verkörperung das letzte Refugium des Analogen ins Digitale überführt und dabei zugleich die Konsequenzen dieser Übersetzung reflektiert werden. Der Kontakthof 2.0 sollte mithin eine Idee davon geben, wie Kontakt, Kommunikation, Selbst, Arbeit, Partizipation und vielleicht auch Glück in digitalen Kulturen aussehen.
In dieser Dokumentation werden nicht nur die Arbeiten vorgestellt und archiviert. Sie werden auch im Hinblick auf Methoden für eine wissenschaftliche Untersuchung und praktische Auseinandersetzung mit neoliberalen und digitalen Kulturen ausgewertet. In den Fokus rücken dabei das Embodiment of remix sowie das Performen von Theorie im TheorieTheater. Diese beiden Methoden sollen für das Umgehen mit digitalen Mysterien gesichtet werden, wie es der Aufgabe im letzten Jahr der Forschung (interner Link zum Aufsatz: Mit Foucault …) zu „Re-thinking methods“ im DCRL entspricht.
John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen

Am 9. November 2014 kam das Stück “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen. Einige wissenschafts-performative Erwägungen, sehr frei nach Ibsen, Bataille, Reckwitz und Bröckling” in Hamburg als Erprobung eines Theorietheaters zur Aufführung. Konzept und Regie verantwortete Martina Leeker. Spieler_innen waren: Sven Asmus, Nick Doormann, Monika Kuhrau-Pfundner, Susanne Lange, Constanze Schmidt, Nicole Seiler, Agnes Stangenberg.
Grundlage war das Stück “John Gabriel Borkman” von Henrik Ibsen aus dem Jahr 1896. Im Stück geht es um den Bankier Borkman, der acht Jahre im Gefängnis verbrachte, nachdem er versucht hatte, Gelder seiner Bankkunden zu veruntreuen und in den Aufbau eines gigantischen Erzbergbauwerkes zu investieren. Seit seiner Entlassung lebt Borkman wieder mit seiner Frau Gunhild im Haus von deren Zwillingsschwester Ella Rentheim. Die Eheleute bewohnen getrennte Stockwerke. Die Beziehungsebene der Figuren konstituiert sich aus ökonomischen Erwägungen. So war Ella einst Borkmans Geliebte, die er allerdings aufgab, als Hinkel, Direktor der von Borkman begehrten Bank, sich für sie interessierte. Borkmans Plan war, dem Kollegen die begehrte Frau zuzuführen und dafür im Gegenzug mit der Leitung der Bank betraut zu werden. Ella aber entschied sich gegen eine Beziehung mit Hinkel und Borkman nahm Gunhild zur Frau. Eine zentrale Rolle in den Ekstasen der Gewinnmaximierung und Instrumentalisierung spielt Erhart, der Sohn der Eheleute, der nach der Inhaftierung von Borkman bei seiner Tante Ella aufwuchs. Nunmehr bekämpfen sich die Protagonisten in ihren Ansprüchen an Erhart. Seinem Vater soll der Sohn dafür zur Seite stehen, einen neuen Coup zu starten. Seine Mutter erwartet von ihm, dass er die Ehre der Familie wiederherstelle. Seine todkranke Tante schließlich bittet ihn um Sterbebegleitung. Erhart aber verfolgt eigene Pläne und verlässt mit seiner Geliebten, der geschiedenen, deutlich älteren Fanny Wilton, das Land gen Süden. Das ungleiche Paar plant, die 15-jährige Frida – Tochter von Wilhelm Foldal und Borkmans einzigem, treu ergebenem Bewunderer –, die Borkman von Zeit zu Zeit auf dem Klavier vorspielt, auf die Reise mitzunehmen. Als Ella auf dem Gut eintrifft, um Erhart zu sich zu holen, kommt es zum Zusammenprall der Figuren und deren Interessen, an dessen Ende Borkman aus dem Haus hinausstürmt und in der eiskalten Winternacht im Wald an einem Herzinfarkt stirbt. Die beiden zerstrittenen Schwestern versöhnen sich an der Leiche des einst geliebten Mannes.
Ausgangsidee für die Inszenierung war, Borkman als anti-kapitalistischen Helden zu entwerfen. Dies zu tun, war die ambivalente Konstitution der Figur sowie des Stückes herauszuarbeiten. In Ibsens Stück spielen nämlich zwar auf der einen Seite die Maximierung des eigenen Nutzens, mithin kapitalistische und neo-kapitalistische Werte (exemplarisch: hier), eine zentrale Rolle, die geschäftliche wie private Verhaltensweisen (Eva Illouz) durchströmen und bestimmen. Die Bemühungen der Protagonisten laufen allerdings auf der anderen Seite zugleich derart ins Leere und verenden regelrecht, dass es nahe lag, Figuren und Plot gleichsam gegen den Strich zu lesen und als Widerständige gegen Kapitalismus und zeitgenössischen Neoliberalismus deutbar zu machen. Im Stück “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” wurde dieses Konzept umgesetzt, indem die Frage, ob Borkman als anti-kapitalistischer Held gesehen werden könne, anhand einer Begegnung von theoretischen Texten zum neoliberalen Kapitalismus, vor allem von Ulrich Bröckling und Andreas Reckwitz, mit Spielszenen aus Ibsens Borkman verhandelt wurde. Mit diesen Verhandlungen sollte zudem geprüft werden, ob die Theorien zur neoliberalen Ordnung und Ökonomie die einzig möglichen zum Verstehen der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Lage seien.
Um Borkman als Figur des Widerstands gegen eine unterdessen schon zum wissenschaftlichen Mainstream avancierte, sogenannte neoliberale Ordnung zu erproben, ist diese vorzustellen. Aus dieser Verortung erklären sich auch die Verwendung von Texten von Reckwitz und Bröckling in der Inszenierung.
Unter der neoliberalen Ordnung wird ein Rückzug des Staates aus der Regulierung von Markt und Wohlfahrt verstanden. An dessen Stelle tritt eine Selbstorganisation des Marktes, die vor allem auf Grund sich selbst motivierender und kontrollierender Subjekte möglich wird. Im Gegensatz zum fordistischen, industriellen werden im neoliberalen, postfordistischen Kapitalismus (Uwe Schimank) dabei neue Produkte und Ökonomien relevant. Dazu gehören Dienstleistungen, Wissensproduktion oder kreative Industrien. Diese Marktorientierung sowie das neue, neoliberale, d. h. sich selbst kontrollierende Subjekt werden in der zeitgenössischen Theorie von Andreas Reckwitz mit dem Topos des Kreativitätsdispositivs (PDF) und von Ulrich Bröckling im Typus des unternehmerischen Selbst (PDF) beschrieben. Mit diesen beiden Beschreibungen wird zugleich die neoliberale Gouvernementalität erfasst. Das Kreativitätsdispositiv konstituiere sich aus der dauernden Erzeugung des Neuen, so Reckwitz:
“In der Gegenwartsökonomie sind damit Innovationsökonomie und Kreativökonomie in weiten Teilen eine Symbiose eingegangen. Der kulturell-ästhetische Kapitalismus setzt auf permanente Innovation und zugleich auf immer neue Produkte mit kulturellem und ästhetischem Reiz.”
Das Kreativitätsdispositiv entspräche allerdings keiner freudvollen Produktion und Selbstverwirklichung. Sie mutieren vielmehr zum Zwang, denn man muss kreativ sein, so Reckwitz:
“Kreativität umfasst in spätmodernen Zeiten dabei eine widersprüchliche Dopplung von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ, von subjektivem Begehren und sozialer Erwartung: Man will kreativ sein und soll es sein.”
Gleichwohl funktioniere der Dispositiv nach Reckwitz, denn:
“Die kreative Tätigkeit verheißt einen mit der Arbeit am Neuen verbundenen Enthusiasmus ebenso wie das befriedigende Gefühl, ein scheinbar souveränes Subjekt zu sein.”
Dieses Subjekt ist nach Reckwitz realiter allerdings nicht souverän, da das Kreativ-Sein zum Leistungszwang würde, der, wird er nicht erfüllt, zur Exklusion führe:
“Wenn das Erbringen kreativer Leistungen soziale Inklusion sichert, dann führt ein diesbezügliches Leistungsdefizit entsprechend zur sozialen Herabstufung und Marginalisierung.”
Ulrich Bröckling spitzt die von Reckwitz beschriebene Lage zur Regierung in einer dauerhaften und deshalb zur Selbstausbeutung führenden kreativen Selbstschöpfung des unternehmerischen Selbst zu:
“Das unternehmerische Selbst lebt im Komparativ: Innovativ, findig, risikobereit und entscheidungsfreudig ist man nie genug und darf folglich niemals in der Anstrengung nachlassen, noch innovativer, findiger, risikobereiter und entscheidungsfreudiger zu werden. Die Einsicht, dass es ein Genug nicht geben kann, erzeugt den Sog zum permanenten Mehr.”
Schließlich sitzt das Subjekt mit Bröckling in der Falle:
“Die entrepreneuriale Anrufung konfrontiert die Individuen deshalb mit einer doppelten Unmöglichkeit – mit der, ein unternehmerisches Selbst zu werden, wie mit jener, die Forderung zu ignorieren, eines werden zu sollen. Niemand muss und kann dem Ruf unentwegt folgen, aber jeder hat doch beständig die Stimme im Ohr, die sagt, es wäre besser, wenn man ihm folgte. Der Sog zieht noch in den sublimsten Lebensäußerungen, und seine Kraft bezieht er gerade daraus, dass keine Zielmarke existiert, bei der man halt machen könnte. So wenig es ein Entkommen gibt, so wenig gibt es ein Ankommen.”
Borkman als anti-kapitalistischer Held
Im Abgleich mit den beschriebenen neoliberalen Ökonomien und Selbst-Technologien konnten die Dispositionen der Kunstfigur John Gabriel Borkman herausgearbeitet werden, mit denen er das Neoliberale und Kapitalistische gegebenenfalls versuchsweise unterläuft und die mithin seinen anti-kapitalistischen Heldenstatus legitimieren könnten.
Ausschlaggebend dafür ist (1), dass Borkman sich jeglicher Umsetzung seiner Pläne und Fantasien entzieht, mithin das neo-/kapitalistische Ideal der unbedingten Wertschöpfung nach einer Ökonomie von Kosten und Nutzen unterläuft. Er redet von der bloßen Möglichkeit, statt die Akkumulation und Distribution von Werten umzusetzen. Borkman monologisiert:
“Alle Machtquellen dieses Landes wollte ich mir Untertan machen. Alles, was der Boden und die Berge und die Wälder und das Meer an Reichtümern bargen, – alles wollte ich mir unterwerfen, wollte mir selbst die Gewalt aneignen und dadurch Wohlstand schaffen für viele, viele tausend andere.
[…]
Und drunten am Fluß – horch! Die Fabriken gehen! Meine Fabriken! Alle, die ich hätte schaffen wollen! Hör’ nur, wie sie gehen. Sie haben Nachtarbeit. Tag und Nacht arbeiten sie also. Horch, horch! Die Räder wirbeln und die Walzen blitzen – immer herum, immer herum.
[…]
Mein Reich! Das Reich, von dem ich um ein Haar Besitz ergriffen hätte damals, als ich – als ich starb.”
In seinem im-/potenten Kapitalismus unterläuft Borkman (2) den bis dato für die kapitalistischen und neo-kapitalistischen Ökonomien konstitutiven homo oeconomicus. Dieser agiert nach Joseph Vogl (2007) aus der prekären Verbindung von rationalen Erwägungen mit Begierden und Leidenschaften, die er allerdings zu Interessen und von Profit gesteuertem Verhalten transformieren könne. Borkman dagegen bleibt gänzlich in gleichsam interesselosen Wahnvorstellungen hängen und fantasiert:
“Dieser Hauch weht mich an wie ein Gruß von untertänigen Geistern. Ich wittere sie, die gefesselten Millionen; ich fühle die Erzadern, die ihre schlängelnden, astigen, verführerischen Arme nach mir ausstrecken. Ich sah sie vor mir wie lebendig gewordene Schatten, – in jener Nacht, als ich im Bankgewölbe unten stand, die Laterne in der Hand. Ich sollte Euch befreien damals! Und ich versuchte es. Aber ich vermocht’ es nicht. Der Schatz sank wieder in die Tiefe. Aber ich will es euch zuflüstern hier, in der Stille der Nacht. Ich liebe euch, die ihr scheintot liegt in dunkler Tiefe! Ich liebe euch, ihr lebenheischenden Werte – mit eurem ganzen leuchtenden Gefolge von Macht und Herrlichkeit. Ich liebe, liebe, liebe euch!”
Borkman lebt zudem in der Vergangenheit, gedenkt seiner waghalsigen Unternehmungen und Pläne und repetiert und perpetuiert diese. Damit unterläuft er (3) das von Reckwitz als Konstituens für die neoliberale Gesellschaft herausgestellte Kreativitätsprinzip. Dieses beschreibt Reckwitz:
“Das Kreativitätsdispositiv ist nun in seinem Kern ein soziales Regime des ästhetisch Neuen, es geht ihm und uns nicht mehr primär um politische Revolutionen oder technischen Fortschritt, sondern um ästhetische Reize – ob in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, Kunstwerke, urbane Erfahrungen, Medienangebote, berufliche Herausforderungen, politische Impulse – oder andere Subjekte”
Borkman aber will nichts Neues schaffen. Damit scheint sein Widerstand gegen neoliberale Ordnungen radikaler als die von Reckwitz selbst vorgeschlagenen Auswege, nämlich Nachhaltigkeit und Singularisierung, wenn der Autor schreibt:
“Mehrere Wege einer solchen ästhetischen Ökonomie jenseits des Novitätszwangs bieten sich an: Man kann billige Gebrauchsgüter durch wertvollere, langlebige oder kulturell und ästhetisch befriedigendere Produkte ersetzen. Das ist die Manufactum-Strategie, aber auch die des Slow-Food. Man kann überhaupt statt auf Güter, die immer irgendwann verschleißen, auf Dienstleistungen setzen, die sich wiederholen und für die Individuen Entlastung oder Befriedigung versprechen.
[…]
Es versteht sich von selbst, dass eine solche Einzelstück-Ökonomie nicht auf rasche Selbstveralterung, sondern auf Nachhaltigkeit setzt. Sie richtet sich nicht am Neuen um des Neuen willen aus, sondern am passgenauen relativ Neuen, das dann dauerhaft oder wiederholt genutzt werden kann. Sie verspricht gleichzeitig, für den Produzenten profitabel und den Konsumenten befriedigend zu sein. Sie wendet sich nicht mehr an ein anonymes neugieriges Publikum, sondern an den einzelnen, individuellen Nutzer mit seinen einzigartigen Bedürfnissen, mit dem es zu kooperieren gilt.”
Borkmans ökonomisches Modell sieht dagegen Konsum, Wertschöpfung und utilitaristische Nützlichkeit überhaupt nicht vor. Ihm geht es vielmehr um nutzlose Verausgabungen und Verschwendung.
Schließlich ignoriert Borkman (4) jede Form der Selbstsorge und Selbstkontrolle, die laut zeitgenössischer politischer und kulturwissenschaftlicher Theorien neoliberale Verhältnisse konstituieren, so auch Thomas Lemke:
“Die neoliberale Strategie besteht darin, die Verantwortung für gesellschaftliche Risiken wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut, etc. und das (Über-)Leben in Gesellschaft in den Zuständigkeitsbereich von kollektiven und individuellen Subjekten (Individuen, Familien, Vereine, etc.) zu übertragen und zu einem Problem der Selbstsorge zu transformieren. […] Da die Wahl der Handlungsoptionen innerhalb der neoliberalen Rationalität als Ausdruck eines freien Willens auf der Basis einer selbstbestimmten Entscheidung erscheint, sind die Folgen des Handelns dem Subjekt allein zuzurechnen und von ihm selbst zu verantworten.”
Borkman aber bricht in äußerster Konsequenz am Ende des Stückes tot zusammen, ohne sich um sich oder andere gekümmert zu haben.
Wollte man Borkmans Methoden des Widerstands zusammenfassen, so ließen sich tendenziell äußerst destruktive Vorgehensweisen und Performances anführen. Es gälte, im Symbolischen zu agieren, an Vergangenem festzuhalten, Faszination zu favorisieren und schließlich den Tod als Horizont zu antizipieren.
Würden die Figur der Verweigerung von realer Akkumulation und Distribution mit der Suspendierung von Selbstsorge zusammengedacht, dann scheint in Borkmans Fantasien gar eine Vision des Sozialen auf, mit der sich das Individuum neoliberaler Prekarisierung entzöge. Diese Prekarisierung beruhe nämlich darauf, dass man das Soziale nicht mehr denken könne, wie Isabell Lorey beschreibt.
“In der neoliberalen Dynamik gouvernementaler Prekarisierung wird gerade durch die Angst, existenzieller Verletzbarkeit ausgeliefert zu sein, die Illusion der individuellen Sicherung aufrecht erhalten. Durch den permanenten Wettlauf um die erhoffte bessere Sicherung des eigenen Lebens und jene des sozialen Nahbereichs gegenüber konkurrierenden Anderen wird ausgeblendet, dass ein nachhaltig besseres Leben keine individuelle Angelegenheit sein kann. In den gouvernementalen Subjektivierungen werden die Anforderungen eines präventiven, individualistischen Selbstschutzes, dieser Selbst-Immunisierung in der Prekarisierung allerdings eher affirmiert als infrage gestellt. Soziale Praxen, die sich nicht allein auf das Selbst und das Eigene richten, sondern das Zusammenleben und das gemeinsame politische Handeln im Blick haben, treten mehr und mehr in den Hintergrund und werden als gelebte Realität immer unvorstellbarer.”
Im Ansinnen, ein “Reich” für Tausende zu schaffen, erinnert Borkman dagegen an ein soziales Gebilde, auch wenn er selbst dabei als grandioses, a-soziales Sozialwesen fungiert, das in einer Ökonomie der unproduktiven Verschwendung und Verausgabung sowie im Scheitern eine soziale Ordnung schafft.
Verkörperung/Performance von Theorie
Um im theorietheatralen Experiment zum einen die Theoriebildung zur neoliberalen Ordnung einzubringen und zugleich im performativen Zugriff zu diskutieren, und zum anderen anhand von Borkman Weisen des Widerstands zu ermitteln und durchzuspielen, wurden theoretische Statements von Ulrich Bröckling und Andreas Reckwitz mit Spielszenen aus Ibsens Vorlage konfrontiert.
Den Rahmen der Inszenierung von “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” bildete eine erzählende Einführung in deren Anliegen. Es ginge um die Auseinandersetzung mit der so genannten neoliberalen Gesellschaft, deren unhinterfragte Existenz man als problematisch einschätze. Um eine kritische Distanz einnehmen zu können und die Theorie zu testen, solle sie mit Ibsens Stückvorlage abgeglichen werden. Es wurde deutlich gemacht, dass man sich eine andere Gesellschaft vorstellen könne, in der anti-neoliberale Werte vertreten und gelebt würden.
Informationen zum Ablauf des Stückes von Ibsen, die für das Verständnis des Unterfangens nötig waren, wurden erstens in Form von Erzählungen vermittelt, die aus Inhaltsangaben zu Ibsens Stück bestanden.
Die Übergänge zu Szenen wurden zweitens hergestellt durch Erzählungen, bestehend aus Regieanweisungen aus Ibsens “Borkman”.
In den ausgewählten theoretischen Texten der Autoren wurden das Kreativitätsdispositiv sowie das unternehmerische Selbst als Faktoren neoliberaler Organisation, Ökonomie und Gouvernementalität eingespielt. Es zeigte sich allerdings in den Proben, dass die theoretischen Texte nicht ausreichend verstehbar waren, wurden sie nur gesprochen. Aus diesem Grund wurden sie in unterschiedlichen Modi gespielt, d. h. inszeniert und aufgeführt. Grundlage dafür waren die so genannten Personnagen. Sie wurden nach der Methode des Theater- und Schauspiellehrers Jacques Lecoq entwickelt (siehe hier [PDF, S. 11–12]), der unter anderem Lehrer und Inspirator von Ariane Mnouchkine (Arbeit mit Masken der Commedia d’ell arte), Yasmina Reza oder Christoph Marthaler (Hotel Angst, [Playlist]) war. In Lecoqs Methode geht die Konstruktion der Personnagen von einer rein formalen, nämlich der körperlichen Gestaltung aus, was diese Arbeitsweise von der auf psychologischen Imaginationen beruhenden Rollenarbeit nach Stanislawski unterscheidet. Damit operiert der Spieler nach der Methode Lecoqs mit Mustern, die keine Einfühlung oder psychische Logiken nach dem Modell eines inneren Selbst, sondern vor allem Verkörperung erfordern. Die Spieler_innen sind gleichsam Präsentator_innen dieser Muster. Diese Konstitution der Personnagen ermöglicht es dann, bei der Gestaltung von Texten aller Art ohne Bezug zum Inhalt mit Stimmhöhen, Tempi oder Haltungen zu experimentieren. Mit dieser Methode wird zudem eine schnelle Erkennbarkeit ermöglicht, so dass ein Spieler, eine Spielerin auch verschiedene Figuren präsentieren und schnell zwischen ihnen wechseln kann.
Ein Modus der Verkörperung von Texten war die an das Publikum gewandte, in den Personnagen verankerte Deklamation der Texte, mit der sie zu Statements der Figuren wurden. Diese wurden unterbrochen mit Arbeiterliedern, die durchaus als eine Reminiszenz an die auch von Isabell Lorey angebrachte und hier schon zitierte Option gemeint waren, mit sozialen Ordnungen die selbsttechnologischen neoliberalen Regulierungen zu unterlaufen.
Der zweite Modus der Verhandlung der theoretischen Kontexte waren so genannten “Theorie-Tische”, in denen, ähnlich dem Verhaltenskodex und Sprechduktus in K-Gruppen, zentrale Thesen von Reckwitz und Bröckling und deren Bezug zu Ibsens Stück und seinem Protagonisten Borkman verhandelt wurden. Auch an diesen Theorie-Tischen wurden die theoretischen Fragmente von den Personnagen verkörpert.
Eine andere dramaturgische Methode zur Verkörperung der theoretischen Texte sowie der Bezugnahme auf eine Spielszene nutzte der “Theorie-Tisch 2”, in dem die Spieler_innen neoliberale Positionen affirmierten und deren Vorteile herausstellten. Hier wurde also mit dem Mittel der Ironie gearbeitet.
Die Spielszenen sollten die theoretischen Einlassungen je konterkarieren, indem sie z. B. das kreative Subjekt ad absurdum führten, wie etwa den dichtenden Foldal, der jedoch wenig Neu-schöpfendes oder Ästhetisches zu Wege bringt.
Oder sie zeigten die Versteinerung der ökonomisierten Beziehungen.
Digitale Ökonomie der Verausgabung und Verschwendung
Die mit der Kopplung von Theorie- und Spielszenen intendierte Spiegelung und direkte Bezugnahme löste sich nur bedingt ein. Vielmehr blieben beide Ebenen nebeneinander stehen, konnten, mussten aber nicht zwingend aufeinander bezogen werden. Das beeinträchtigte den Genuss der Zuschauer_innen allerdings nicht. Es entstand vielmehr ein dramaturgisch dicht gewebtes und vernetztes Angebot für mäandernde Bezugnahmen. Diese konnten durchaus auch unterbleiben, so dass zwei Welten auf der Bühne nebeneinander standen, die jede für sich ihren Reiz hatten.
Entscheidend für die Auseinandersetzung mit dem Stück als Versuch zu einem Theorietheater ist nun der Effekt, dass die Verkörperung von Theorie sowie die Performativität der Spielszenen die eingebrachte Diskurslandschaft zur neoliberalen Gesellschaft gleichsam überrollten. Das Spielen und Verkörpern der Szenen verselbständigte sich und erzeugte eine eigene Welt, mit eigenen Dynamiken und Logiken; ein Vorgang der nicht vorhersehbar und planbar war. So erfanden die Spieler_innen in Improvisationen zur Entwicklung und Gestaltung der “Theorie-Tische” eigene Texte und Szenenverläufe, die sich selbstbezüglich und in der Logik des Performativen, als Fluss des Spiels und der Unvorhersehbarkeit, aneinander hochschaukelten.
Aus der Diskussion der Frage, ob Borkman als ein neoliberaler Held gesehen werden könne, wurde so eine Ansammlung von Versatzstücken für eine Kritik des Konzeptes der neoliberalen Gesellschaft, mitsamt des Kreativitätsdispositivs und des unternehmerischen Selbst. Diese Ansammlung kann versuchsweise zu einer Theorie der Ökonomie der Verausgabung und Verschwendung in digitalen Kulturen ausbuchstabiert werden. In diesem Gedankenexperiment bilden die weiter oben ausgeführten Topoi, die Borkman als anti-kapitalistischen Helden auszeichnen sollten, sowie die Spielszenen, in denen die Theoreme der kreativen Neoliberalität diskutiert wurden, selbst Bausteine einer Theorie zu einer anderen Konstitution der neoliberalen Ökonomie, bzw. zu einer, die neben der im theoretischen Mainstream beschriebenen besteht. Im Zentrum dieser anderen Theorie steht, dass Borkman sich marktwirtschaftlichen Logiken widersetzt und sich und Ressourcen verschwendet.
Das Prinzip der Verschwendung und Verausgabung entwarf Georges Bataille in seiner allgemeinen Ökologie (Ingeborg Szöllösi, 2013. Vgl. auch: Oliver Ruf, Ökonomie der Vergeudung. Die Figur der Verausgabung bei Georges Bataille, in: Hg. Christine Bähr, Suse Bauschmid, Thomas Lenz, Oliver Ruf, Überfluss und Überschreitung. Die kulturelle Praxis des Verausgabens, Bielefeld 2009, S. 27-40.) In dieser geht es um den größtmöglichen Verlust und die unproduktive Produktion, ohne Nützlichkeit und Zweck. Ingeborg Szöllösi fasst zusammen:
“Bataille setzt auch im ökonomischen Zusammenhang auf den Exzess – die Überschreitung und Steigerung des Lebens. Sich ohne Berechnung zu verschwenden, ist nicht nur eine Maxime des hingebungsvoll liebenden Menschen, sondern eine Empfehlung für eine global angelegte Ökonomie, die sich zu jeder Zeit ihres Reichtums gewiss ist und keine Verluste scheut.”
Was Bataille nun allerdings als Gegenentwurf zur verhassten, rationalistischen Ökonomie ansah, die den Menschen zum Mängelwesen degradierte und Lust, Genuss ebenso ausblendete wie Verlust, Leid und Vergeudung, wäre als eine andere, dann weniger erfreuliche Sicht auf die Konstitution neoliberaler Ökologie zu verstehen. Es geht mithin nicht um eine Alternative, sondern um einen neuen Zustand des Kapitalismus. Es geht nicht um dessen Ende, sondern seine Verfasstheit in digitalen Kulturen. Dies gilt, wenn davon ausgegangen wird, dass sich diese Kulturen vor allem aus Infrastrukturen konstituieren, in denen, im ökonomischen, wie im sozio-technischen Sinne, mit Daten gehandelt wird. Diese Daten-Ökonomie entspricht einer des Verausgabens und Verschwendens, mit der nicht mehr etwas geschaffen oder Produktion und Wachstum organisiert wird. Es geht vielmehr um das Vergeuden von Daten um des Gefallens und Verlierens und Verausgabens willen. Neben den quantifizierten Selbsten und geprofilten Nutzern ist die akademische Welt der Drittmittelanträge ein probates Beispiel für diese Umstellung. Zwar werden in eingeworbenen Projekten auch Dinge hergestellt und Themen bearbeitet. Die Projekte dienen aber vor allem dazu, umgehend und wie im Rausch neue Projekte zu ersinnen und sich an deren Beantragung zu verausgaben. Unabhängig davon, ob ein Projekt kommen wird, geht es zunächst vor allem darum, sich zu vergeuden, zu geben, ohne Ansinnen nach Profit und Entschädigung.
In dieser digitalen Ökonomie wäre der Mensch kein sich selbst kontrollierendes Subjekt mehr. Er ist vielmehr Spielfigur auf der Bühne sich selbst organisierender und Wirklichkeit halluzinierender Geräte und Algorithmen. Vor diesem Hintergrund gerät die Theorie zur neoliberalen Ökonomie zu einem Diskurs, der im anthropologischen Notzustand des Digitalen auftaucht. Der Neoliberalismus halluziniert nämlich zumindest noch ein Subjekt, während realiter dieses schon längst auf die technischen Bühnen abgetreten ist und, wie Borkman, Wahnvorstellungen, Faszinationen und affektiven und affizierten Fantasien folgt und sich darin immer wieder neu erregt und belebt, mithin verschwendet, um sich wieder neu zu erregen und zu beleben.
Zu einer ähnlichen Diagnose kommt auch Joseph Vogl, wenn er ausführt, dass der ökonomische Mensch in neoliberalen Zeiten nur noch eine abstrakte, heuristische Figur sei:
“Der ökonomische Mensch fungiert damit als eine Art theoretischer Sonde, als Testverfahren, mit dem etwa die Funktionstüchtigkeit von Institutionen, von Organisationen, von Kommunikationsformen erprobt und überprüft werden. Er ist von einem mehr oder weniger realen Wesen zu einer heuristischen Figur geworden, zu einem reinen Rollen-Konstrukt, mit dem man von Fall zu Fall situationsabhängige Entscheidungsprozesse analysiert. Andererseits aber – und das ist der andere Aspekt – tritt umgekehrt der unökonomische Restmensch, der ‘ganze Mensch’ als neuer Produktivfaktor auf den Plan. Mit einem jüngsten Innovationsschub ist man auf ungehobene Ressourcen gestoßen und verlangt von der neueren Ökonomie, dass sie die Grenzen des Ökonomischen selbst überschreite und die Kapitalien der Alltagswelt, der Lebenswelt, der Beziehungswelt erschließe. Von der Ökonomie wird eine Art ‘Vitalpolitik’ verlangt, die die Individuen ganzheitlich, von morgens bis abends, als Familienwesen und Zeugungsanstalten, als liebende und träumende, als gesunde und kranke in Rechnung stellt.”
Und bezogen auf die zu oft vernachlässigte technologische Konstitution und Bedingung der neuen Ökonomie schreibt Vogl, wie er selbst sagt, nebenbei:
“Vielleicht ist – das sei nebenbei bemerkt – die andere, technische Seite dieser Mutation jene Veränderung, mit der der Supercode des Gelds durch den Hypercode digitaler Information abgelöst und partikularisiert wurde: Wer zahlt, zahlt auf den Märkten immer noch mit Geld; er bezahlt aber Geld immer schon mit Information. Im Informationssystem, in seinen technischen und symbolischen Bedingungen, erreicht die Ökonomie nicht nur ihre äußersten, bislang unüberschreitbaren Grenzen; sie ruft damit auch die Figur jenes ganzen oder generellen Menschen auf, der sich Humankapital nennt. Das ist die Vergangenheit des Mediums, des älteren homo oeconomicus: Er räumt den Platz für eine neue Menschen-Variation, die ökonomisch gerade dadurch operiert, dass sie sich selbst, ihre Subjektivität, ihre Spiritualität produziert.”
Mit diesen Befunden und ausgehend vom durch Borkman angeleiteten Gedankenexperiment werden sowohl das unternehmerischen als auch der kreative Selbst fragwürdig. Borkman, es wurde schon gesagt, erschafft nicht Neues und er sorgt nicht für sich. Er ist selbst-los, verschenkt sich an seine Träume und Wahnvorstellungen. Effekt ist eine Art der Dauererhitzung, die immer läuft und immer wieder ins Nichts und den Verlust mündet. Es geht um eine Leerstelle des Selbst der Illusionierung und Im-/Potenzierung.
Im Performativen kommen dieses leere Selbst, diese Selbst-losen im theaterästhetischen Modus der Figuren zum Tragen. Sie sind Chiffren, die sich zu Verkehrswegen und Knotenpunkten formieren, ohne je ein Innen zu entwickeln.
Aus den angestellten Analysen und Gedankengängen wären andere Formen des Widerstands als die von Reckwitz vorgeschlagenen und hier bereits skizzierten der Nachhaltigkeit und Singularisierung zu entwickeln. Es wäre vor allem eine Trennung von Maschinenträumen zu leisten. Zweitens wären soziale Konstellationen zu schaffen, in denen aus der Verausgabung und Verschwendung ausgestiegen wird.
Aus den Analysen und Gedankenexperimenten ergibt sich eine Einsicht in Theorietheater, die im Weiteren ausgeführt wird. Es würde nicht mehr für eine Auseinandersetzung mit theoretischen Kontexten einstehen, sondern vielmehr im Performativen eigene theoretische Versatzstücke hervorbringen. Theorietheater würde zu einem diskursanalytischen Experimentalraum von Theoriebildung und Wissensgenerierung.

TheorieTheater mit Borkman (Teil II – theoretisch)
Überblick. Theorie und Theater, technologisch
Die Verknüpfung von Theater und Theorie im Theorietheater findet in einem konkreten technikgeschichtlichen Moment statt, nämlich in den technologischen Bedingungen digitaler Kulturen, den es aufzuarbeiten und dessen Relevanz es zu ermessen gilt. Dies ist von Nöten, damit diese Form von Experiments&Intervention als Methode zur Auseinandersetzung mit digitalen Kulturen nicht möglichen Vereinnahmungen durch diese anheim fällt.
Auffällig wird, dass im Kontext von Theater und Theorie an die seit den 1990er Jahren stattfindende starke Betonung und Umdeutung des Performativen angeschlossen wird. Mit dieser kam dem Performativen die Vorstellung von ihm vorgängigen Subjekten und Wirklichkeiten abhanden. An deren Stelle tritt eine Eigentätigkeit performativer Vollzüge, etwa die Aus- und Aufführung von Sprechakten, die qua Konvention oder rituelle Praxen Subjekt und Wirklichkeit erst hervorbringen sollen. Damit werden diese zugleich höchst unsicher, denn, wie Sybille Krämer vermerkt, ist Performativität per se Veränderung qua Wiederholung:
“Die Debatte über ‘Performance’ und ‘Performativität’ in den Kulturwissenschaften erinnert uns daran, dass ‘Performativität’ nicht einfach heißen kann, etwas wird getan, sondern heißt, ein Tun wird ‘aufgeführt’. Diese Aufführung aber ist immer auch: Wiederaufführung. Die Wiederholung, also Iterabilität, die zugleich immer ein Anderswerden des Aufgeführten einschließt, ist überall da am Werke, wo wir von etwas sagen können, daß es eine performative Dimension aufweist.”
Diese Modellierung von Performativität als Medialität findet, dies gilt es zu beachten, im Kontext sich selbst organisierender, d. h. seit den 1950er kybernetischer Umwelten statt. Diese zeichnen sich durch Performativität aus in dem Sinne, dass sie etwas aus- und aufführen und nicht bloß repräsentieren; wie etwa der Code des Computers. Die Performativierung von Existenz und Kommunikation in den Kultur- und Geisteswissenschaften entspricht mithin der in Medien und technischen Umwelten. Kultur- und Geisteswissenschaften antworten zudem auf das Eigenständig-Werden der technischen Umwelten mit dem Entwurf von Handlungsagenturen (PDF, Bonz 2007) und kooperativen Konstellationen (Gießmann/Schüttpelz 2014) zwischen technischen Dingen, Umwelten und Medien, in denen Menschen keine besondere Rolle mehr einnehmen.
In diesem Zusammenhang steht nun die Verbindung von Theorie und Theater insofern für eine Austreibung des Subjektes einerseits und eine Agenturisierung andererseits, als durch die Performance von Wissen, Denken und Theorie diese in den Sog der Wiederholung und damit der Veränderung sowie der Wirklichkeit generierenden Eigentätigkeit gelangen. Somit gehört dem Menschen nichts mehr, auch nicht das bis dahin dem Theater zugeschriebene Reflektieren, mithin die Möglichkeit zu Distanz und Kritik. Mensch ist Performance und findet keinen Halt innerhalb der dauerhaft instabilen Agenturen und Kooperationen. Damit wäre Theater im Verbund mit Theorie an der Umstellung von Kultur und “Mensch” auf technologische Bedingungen beteiligt. Die Stoßrichtung ist deutlich und entspricht der hier vermerkten, wenn Achim Geisenhanslüke zum Theorietheater von René Pollesch, Pionier der Integration theoretischer Texte in Theater, schreibt:
“Sich von sich selbst zu befreien, scheint daher eine der Aufgaben zu sein, die die Gegenwart dem Subjekt stellt. Nicht mit sich identisch sein, sondern nicht mehr mit sich identisch sein, ist das Credo der Zeit.”
Diese Umwälzungen sind nicht per se als negativ anzusehen, da es nicht um Bewertungen von Modellierungen des Anthropologischen oder Medialen gehen kann, wo diese immer schon diskursive Erfindungen sind. Ein Bewusstsein für diese Involvierung des Theaters mit Theorie zu entwickeln, um sich gegebenenfalls auch gegen sie zu stellen, wäre gleichwohl wünschenswert.
Das Stück “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” und dessen Inszenierung wären nun in diesem technikgeschichtlichen Kontext zu betrachten und im Hinblick auf seine Form der Involvierung in diesem zu analysieren. Es steht in Frage, ob mit der Entwicklung einer eigenen Theorie im Performen auch ein Ausstieg aus der möglichen Involvierung, zumindest aber ein Beitrag für deren Reflexion geleistet werden kann.
Die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Theorie und Theater erfreut sich seit Beginn der 1990er Jahre eines großen Interesses in der Theater- und Kulturwissenschaft. Beispiele für diesen Bereich sind etwa die Theaterstücke von René Pollesch, in denen theoretische Texte, z. B. aus Genderstudies oder Politikwissenschaft, als Sprechblasen für Spielfiguren-Darsteller_innen eingefügt werden. Eine andere Variante ist das so genannte “Forschende Theater” (PDF, Sibylle Peters 2013), das selbst wieder unterschiedliche Formen annehmen kann, die vom partizipativen Lern-Theater über Lecture Performances (Sibylle Peters 2011) bis hin zu urbanen Performances (Imanuel Schipper 2013) reichen kann, mit denen z. B. ein Stück Geschichte erkundet und erprobt wird. Oder es handelt sich um ein Denken auf der Bühne (Arno Böhler), mit dem eine andere Weise des Philosophierens versucht werden soll, die aus Verschiebungen und Unterbrechungen von Wissen und rationaler Stringenz durch Verkörperungen und Performances entsteht.
An dieser Stelle soll nun erkundet werden, woher das Interesse an der Verbindung von Theorie bzw. Denken mit Theater kommt und welche Aufgaben sie haben könnte. Die Beantwortung dieser Frage, die hier nur ein erster, unvollständiger Versuch sein kann, geht von der Beobachtung aus, dass bei allen Unterschieden in der Erprobung der Verbindung von Theater und Theorie das Performative eine zentrale Rolle spielt. Gemeint sind damit zum einen die Verkörperung von Texten oder wissenschaftlicher Forschung sowie zum anderen die Betonung des Vorgangs des Aus- und Aufführens von Handlungen als eigene, kulturell wirksame Kraft. Es geht mithin um einen Performativierungsschub mit dem Effekt einer nicht mehr rückgängig zu machenden Verzeitlichung von Existenz und Handeln. Es kommt zudem zu einer Entfesselung nicht mehr vollends kontrollierbarer Kräfte, da sich immer wieder Parasitäres in Kommunikation, Wissen sowie den Bezug zu Wirklichkeit einmischt. Wird dieser Schub im Umgang mit theoretischen Texten vollzogen, dann setzt damit eine Destabilisierung von verbindlichem Wissen ein, das durch Experimente zu Methoden des Wissenserwerbs ersetzt wird. In diesen Experimenten avancieren die Medialität und Materialität der Existenz und damit eine Ontologie fehleranfälliger Übersetzungen zwischen unterschiedlichen Systemen zum Status Quo.
These ist, dass ein Auslöser für diese Umstellung auf eine existentielle Performativität die in den 1950er Jahren aufkommende Kybernetisierung (Claus Pias 2004) ist, die aktuelle digitale Kulturen begründet und weiterhin ausmacht. Mit dieser werden nämlich technische Dinge gleichsam eigenständig und eigensinnig aktiv und dem Menschen dadurch eine neue Rolle und Konstitution abgerungen. Denn kybernetische Maschinen werden zu sich selbst organisierenden Entitäten und der Mensch wie diese zu einem informationsverarbeitenden System. Die Betonung des Performativen, die in der Sprachwissenschaft (John Langshaw Austin 1955/62 [PDF], Jacques Derrida 1971 [PDF], Gerd Posselt 2003) begann und in Kunst und Theater ausbuchstabiert wurde, läuft seit den 1960er Jahren auffälliger Weise mit der Entfesselung technischer Dinge parallel. Diese Betonung ist nicht zufällig, sondern sie folgt, so der Gedanke, vielmehr der technologischen Bedingung computerisierter Technosphären. Diese entstehen nämlich aus der technischen Verfasstheit des Computers in Codierungen, die etwas ausführen, mithin performen, und die beschriebene Automatisierung erst ermöglichen. Inke Arns führt aus:
Man könnte sogar behaupten […], dass es sich bei […] Programmiercodes um illokutionäre Sprechakte handelt, insofern, als hier ‘Sagen’ und ‘Tun’ zusammenfallen, diese ‘handlungsmächtigen’ Sprechakte also keine Beschreibung oder Repräsentation von etwas sind, sondern direkt affizieren, in Bewegung setzen, Effekte zeitigen.
Friedrich Kittler verwies in seinem Text ‘Die Schrift des Computers: A license to kill’ diesbezüglich bereits auf den doppeldeutigen Begriff der ‘Kommandozeile’, einem Zwitterwesen, das heute in den meisten Betriebssystemen durch graphische Benutzeroberflächen fast verdrängt worden ist. […] Kittler schreibt weiter: ‘Im Computer […] fallen, sehr anders als in Goethes Faust, Wort und Tat zusammen. Der säuberliche Unterschied, den die Sprechakttheorie zwischen Erwähnung und Gebrauch, zwischen Wörtern mit und ohne Anführungszeichen gemacht hat, ist keiner mehr. Kill im Kontext literarischer Texte sagt nur, was das Wort besagt, kill im Kontext der Kommandozeile dagegen tut, was das Wort besagt, laufenden Programmen oder gar dem System selbst an.
Um die technischen “Performances” als solche bezeichnen zu können, bedarf es allerdings zwingend einer Umdeutung von Performativität. Dies leisten die “Humanities” sowie die Kunst. Der Beitrag der Performativierung von Kunst und Kultur besteht nämlich darin, dass mit ihr das Performative vom Menschen mit Intentionen und Willen befreit und auf das Operative umgelegt wurde und wird. Der zweite Effekt, den die Parallelisierung von Performances von Codes und Menschen zeitigt, ergibt sich daraus, wie über das Performative die Bildung von Subjektivität sowie die Konstitution von Kommunikation nicht einfach abgeschafft, sondern reformuliert wurden. Ausgangspunkt ist, dass die Codierung im Computer über Schichten von Übersetzungen (PDF, Jens Schröter 2013) zwischen Maschinensprachen, Programmiersprachen, Interfaces, Protokollen und Oberflächen etwas ausführt (PDF, Susha Niderberger 2013), wobei die Übersetzungswege nicht mehr in Gänze nachvollziehbar sind, auch wenn sie auf der technischen Basis hochgradig geregelt sind. Auf diese Konstitution reagieren die geisteswissenschaftlichen Theorien des Performativen mit einer Umstellung der Modellierung von Existenz auf eine mediale in Übersetzungen. In dieser werden nicht mehr Wirklichkeiten in Sprachen abgebildet, sondern vielmehr Regelwerke und Konventionen miteinander verschoben. Mit diesem Vorgang erst sollen Subjekte oder Wirklichkeit entstehen. Das heißt, die Sprach- und Kulturwissenschaften antworten auf die kybernetische Revolution zum einen mit einer Modifizierung des Verständnisses von Performativität und passen diese den technischen Operationen an. Zum anderen werden Kommunikation und In-der-Welt-Sein zu einem Prozess von Übersetzungen erklärt, die in performativen, d. h. Medien aufführenden Operationen diese erst erzeugen.
Diese Konstitution wird zugleich insofern zur einzig denkbaren Möglichkeit von Subversion, als Verkörperung und Vollzug, verstanden als Kaskaden der Übersetzung, Verschiebungen entsprechen und somit gleichsam a priori Reformulierungen ermöglichen sollen. Das Aufgeben von Intentionalität und Handlungsmacht im Performativen entspricht mithin der Rettung vor der Herrschaft kybernetischer Regulierung und Kontrolle.
Theater, Kunst und Performance werden in dieser Lage seit den 1960er Jahren zu einer Art Labor, in dem der Umgang mit dieser ambivalenten, da zugleich geregelten und entfesselten Lage erprobt wird, vgl. exemplarisch: 9 Evenings. Theatre and Engineering, 1966, New York. Hier werden entfesselte technische Umwelten von den Performances hergestellt, in denen technische Dinge Sound- oder Filmlandschaften eigentätig herstellen. Damit setzen sich Künstler_innen dem Performativen aus und erproben dabei das kreative Potenzial von Regelübertretung und Verschiebungen der Übersetzungen. In diesem Vorgang werden letztere zugleich gleichsam kultiviert und diszipliniert, z. B. durch Vorschriften, wie Kunst und Performance auszusehen und zu wirken haben. In dieser Erprobung wird also in einer neuen Ästhetik des Werdens oder der Unvorhersehbarkeit Kontrolle über performative Situationen abgegeben. Dies dient allerdings vor allem dazu, Formen der Kontrolle (Leeker 2012) zu entwickeln, in denen Subjekte in eine Handlungsagentur mit Dingen und Umwelt treten.
Was in den 1960er Jahren mit einer Entfesselung technischer Dinge in Performances mit ihnen begann, setzt sich, so die These, seit den 2000er Jahren im Spiel mit Theorie in Performances fort. Wenn Interesse an der Verbindung von Theater und Theorie unter besonderer Berücksichtigung der Performativierung einsetzt, dann bedeutet dies, so die These, eine Anpassung der Vorstellungen von Wissen und Wissenschaft an die sich fortsetzende kybernetische Wende. Die Fokussierung auf Theorie und die Generierung von Wissen könnte z. B. mit der Kooperation von Wissenschaft und über Computer geregelte Simulationen (Claus Pias 2011, Sybille Krämer 2009 [PDF]) zusammenhängen, mit denen Wissen zu operativen Berechnungen und damit prekär und nicht mehr in Gänze nachvollziehbar wird.
Das Verhältnis von Theater und Theorie ist mithin kein Gegebenes, sondern ein über die Umdeutung von Performativität unter technologischen Bedingungen diskursiv erzeugtes. Soll die Verbindung von Theater und Theorie nun als Methode der Forschung und Reflexion sowie der Wissenserzeugung eingesetzt werden, dann ist diese diskurs- und technikgeschichtliche Situation zu bedenken, um nicht Teil der Kompensationsleistungen zu werden. Das Unternehmen steht vor der schwierigen Situation, dass diskursiv erzeugte produktive Potenzial der Aus- und Aufführung von Theorie zu erproben, ohne dessen gouvernementalen Effekten anheim zu fallen. Zugleich ist davon auszugehen, dass das Performative als eine Art Supermedium, nämlich der Verkörperung sowie des Gebrauchs anderer Medien, eine eigene Wirkung hat, die jenseits der diskursiven Ausformungen besteht. Die produktiven Aspekte des Performativen liegen, wie auch die Inszenierung von „John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen“ deutlich machte, in der Verkörperung von Theorien, in der sich neue und unerwartete theoretische Erkenntnisse zeigten, sowie in der Unabgeschlossenheit von Wissen, das sich durch die Zeitlichkeit des Auf- und Ausführens ergibt. Mit diesem wird Wissen als instabil gekennzeichnet und als Veränderbares ausgewiesen und soll schließlich dauerhaft von parasitären Besiedelungen bedroht sein. Zum anderen wird es ein vom Parasitären durchsetztes Darstellen konstituierten.
Im Weiteren sollen für das Praxisfeld von Theater mit Theorie theoretische Einwürfe und Reflexionen versammelt werden, die Aspekte aufführen, die bei Experimenten mit Theorie und Theater zu beachten wären.
Sie beziehen sich auf die vermeintliche Ur-Szene der “Theoria”, nach der Theater und Theorie gleichursprünglich seien. Dieses Modell entpuppt sich allerdings selbst als ein Diskurs mit dem Effekt, Medienreflexivität zu erzeugen. An die Stelle der verallgemeinerten Ur-Szene hätten vielmehr eine historische Fallstudien zu treten, die zeigen, dass die Verknüpfung von Theater und Text vor allem kulturtechnische Gründe hatte, da mit ihr Lesen von laut auf leise umgestellt und damit erst eine im Inneren beheimatete Subjektwerdung entstand.
Vor dieser Folie erscheint dann der bereits beschriebene Performativitätsdiskurs als Austreibung dieses Subjektes erneut auf.
Ausgangspunkt dafür, die Verbindung von Theater und Theorie zu diskutieren, ist in der zeitgenössischen medien- und theaterwissenschaftlichen Forschung, dass Theater im Griechischen mit “Theorie” verwandt ist und von Beginn an eine Kopplung von Schauen, Erkennen und Reflexivität bestanden habe. So schreiben Gerald Siegmund und Georg Döcker:
“théôria verweist im Kern auf die bekanntermaßen gemeinsame Wurzel von Theater und Theorie, thea, die Schau – in der auch theos, Gott, seine Spuren hinterlassen hat –, die auf das zu Schauen geben von Dingen abzielt. Im 5. und 6. Jahrhundert vor Christus beschrieb das Konzept der Theorie zugleich eine körperliche Praxis, die darin bestand, das ausgewählte reiche Bürger einer Polis aufbrachen, durchs Land reisten, um an einem anderen Ort Theateraufführungen oder religiösen Ritualen beizuwohnen. Dort debattierten sie über das Gesehene und Gehörte, fällten ein Urteil oder fanden zu einer Beschreibung der Ereignisse, bevor sie schließlich in ihre jeweiligen Städte zurückreisten, um in einem formalen Akt von den Ereignissen zu berichten, die sie geschaut hatten. Theorie diente zum Bezeugen einer Aufführung. Im Begriff Theorie verbanden sich die Wahrnehmung – aisthesis – eines Schauereignisses mit einer geteilten Praxis des Beschreibens und Urteilens.”
Auf dieser Grundlage hat Freddie Rokem die Philosophie ins Spiel gebracht, zu der performative Künste insofern eine enge Verbindung aufrechterhalten würden, als Denken eine sinnlich-körperliche Seite haben müsse. Dies entstehe aus dem Impetus des Theaters, Texte zu verkörpern (Philosophy on stage, Arno Böhler).
Dieses “ur-szenische” Denkmodell zur Beziehung von Theater und Theorie schreibt sich auch da fort, wo Theater als das Andere von Wissen und Wissenschaft entworfen wird. Als solches steht es für Komplexität, Unsichtbarkeit und Offenheit des Sinns und wird als Garant für ein anderes Wissen angesehen. Nikolaus Müller-Schöll fragt: “Was heißt es, szenische Vorgänge als Denken zu begreifen? Und was andererseits hat es mit dem jedem Denken eigenen Theater auf sich? Gibt es andere Formen des Denkens als dasjenige in Begriffen?” (hier). In einer ähnlichen Logik argumentieren noch einmal Siegmund und Dönker:
“Bevor Platon und Aristoteles die Theorie ein Jahrhundert später auf die geistige Schau, die Schau von Ideen oder das Studieren von physikalischen und metaphysischen Konzepten einengten, findet sich also ein offener Begriff von Theorie als einer körperlichen Praxis des Sehens, Sprechens und Wahrnehmens. Theorie nicht als Gegensatz zur aisthesis aufzufassen, sondern sie als deren Bestandteil zu begreifen, […].”
In diesem Horizont beschreibt die Bochumer Theaterwissenschaftlerin Ulrike Hass, im Folgenden nach einem Interview paraphrasiert:
“Durch analytische Verfahren wird eine Erkenntnis über etwas ermöglicht. Szenische Forschung ist dagegen ohne Objektbezug. Erkenntnis richtet sich nicht auf etwas, sondern der Forschende versucht, sich dem zu Erforschenden ähnlich zu machen, in dem Sinne, dass er sich von ihm affizieren lässt, sich auf einen Prozess einlässt, so dass sich auch eine Forschungsfrage verändern oder im Prozess erst entstehen kann.”
Schließlich gehört auch der Zugang aus dem Kontext des “Philosophierens auf der Bühne” dazu, zu dem Arno Böhler schreibt, es ginge um die: “Aufmerksamkeit für den Körper als Ausgangspunkt und sinnstiftendes Medium wissenschaftlichen Denkens, Vortragens und Schreibens” (hier). Und weiter mit Böhler:
“Im Unterschied zu einer (bloß) diskursiven Kritik herrschender Sitten wird ein Denken Korporaler Performanz daher die Widerständigkeit mitbedenken müssen, die in der materiellen Weigerung liegt, bestimmte Verkörperungsriten einfach zwänglich zu wiederholen, indem man sich widersetzt, sie am eigenen Leib weiterhin gedankenlos naiv zu replizieren. Das […] Forschungsprojekt Korporale Performanz hinterfrägt solche materiellen Riten wissenschaftlicher Praxis, indem es der Frage nachgeht, ob diese meist unreflektiert bleibenden materiellen Rahmenbedingungen akademischer Wissenspraktiken nicht eine bedeutungsgenerierende Funktion für wissenschaftliche Theorien besitzen, die aufzuzeigen an der Zeit wäre.”
Auch die Sicht, dass von der Unvereinbarkeit von Theater und Theorie auszugehen sei, ist Teil der Ur-Szene, gleichsam deren andere Seite (Hg.: Astrid Hackel, Mascha Vollhardt, Theorie und Theater: Zum Verhältnis von wissenschaftlichem Diskurs und theatraler Praxis, Wiesbaden 2014, hier). Die Unvereinbarkeit entstünde daraus, dass gerade im Verkörpern von Figuren, Texten oder Situationen immer ein Überschuss entstehe, der sich nicht in Theorie oder als Theorie einholen ließe. Theater würde vielmehr Theorie in ihrer Fremdheit und Unverständlichkeit ausstellen und erhalten.
Die als genuin angenommene Verbindung von Theater und Theorie im antiken theatron ist gleichwohl mit Vorsicht zu genießen, weil sie ein mediales Apriori erzeugt, dass weniger dem Ort selbst und seinen Aufführungspraxen, als vielmehr einem medientheoretischen Wollen entsprechen könnte. Dieses ergibt sich daraus, dass die Modellierung von Theater als Theorie der Begründung von Medienwissenschaft als Reflexion technologischer Bedingungen dienlich ist. Wolfgang Ernst verdeutlicht in diesem Kontext die mediale Konstitution von Theater:
“Nehmen wir also Platz im altgriechischen Theater. Das Wort theoría ist wie das Wort théatron von theáomai abgeleitet, und das meint: das ans Auge Gerichtete. Theorein meint zunächst den theatralischen Blick, und theatron im engeren Sinne den Zuschauerraum. […] Dieser Raum des Theaters ist also ein Medienverbund aus Blickschneisen, Akustik und Apparaten – […] Guido Hiß hinterfragte einmal, ob das Theater vor dem Hintergrund aktueller Theorien überhaupt ein Medium darstellt. Doch schon um 440 v. Chr. war sich Theater als Medium bewußt. […] In der theatralischen Schau wird die Theorie selbst zum Medium. Das klingt idealistisch, wird von Nietzsche aber als mediales Dispositiv unter Verweis auf die Geometrie der Architektur decouvriert: ‘In ihren Theatern war es Jedem, bei dem in concentrischen Bogen sich erhebenden Terassenbau des Zuschauerraums, möglich, die gesammte Culturwelt um sich herum ganz eigentlich zu übersehen und in gesättigtem Hinschauen selbst Choreut sich zu wähnen.’ Damit ist mediales theorein als genuin politische Kompetenz angesprochen.”
Theater heißt das, wird zum Garanten dafür, dass Medialität gesehen, in ihren technologischen Bedingungen verstanden und reflektiert werden kann. Dies wird deutlich im folgenden Gedanken von Ernst:
“Das Wort theoría ist wie das Wort théatron von theáomai abgeleitet, und das meint: sehen, contempler, also das ans Auge Gerichtete. Womit Medientheorie nicht schlicht Theorie über Medien wäre, sondern von einem Medium (dem Vokalalphabet für den geschriebenen Text, die Stimme des Vortragenden) selbst hervorgebracht und vom jeweiligen Medium, immediat, reflektiert wird.”
Da im Theater Schauen und Denken in eins fallen sollen, etwa auf Grund der Distanz zum Geschehen, die ob der Trennung von Handeln und Schauen ermöglicht wird, wird es zur Denkfigur für eine Konstitution von Medien, mit der sie sich selbst sichtbar und damit reflektierbar machen können. Dieses Konstrukt könnte ein Grund dafür sein, dass die Dopplung von Theater als Schauen und Reflektieren so prominent ist und als a-historisches Modell tradiert wird. Das heißt, es geht weniger um eine “Ur-Szene” des Medialen als vielmehr um eine Denkfigur, mit der die Reflexivität des Medialen erzeugt und gesichert wird. So wie Theater im Medium Text (z. B. Theaterstück) oder Stimme (Sprechen eines Stücktextes) entsteht und diese in der Aufführung umgehend reflektiert werden sollen, so könnten am Theater geschulte Zuschauer_innen diese Haltung mit sich nehmen und auf jedes andere Medium anwenden. Es geht mithin um ein inneres Theater als eine Kulturtechnik der Distanzierung von Medien.
Theater ist aber nicht a priori der Ort der Reflexion, da es sich nicht allein aus einer technologischen Verfasstheit konstituiert. Vielmehr wäre ein Gefüge bestehend aus unterschiedlichen Faktoren anzunehmen, die die Wirkung eines Mediums erzeugen, darunter die Diskurse, die Effekte mit erzeugen. Selbstverständlich haben Dispositive, zu denen neben dem Benthamschen Panoptikum (Alf Mayer) auch Theaterbauten zählen dürften, eine Wirkung auf Wahrnehmung und Subjektkonstitution. Doch diese entfaltet sich erst mit Zuschreibungen der Wirkungen und deren Performance. Zudem zeigt gerade die Theatergeschichte, dass und wie sich dessen Medialität über die Jahrhunderte ändert und gerade der Faktor der Reflexion immer wieder in Frage gestellt und modifiziert wird.
Vom lauten zum leisen Lesen (Jesper Svenbro)
Um für das Theorietheater eine weniger diskursverdächtige Einschätzung zum Verhältnis von Theorie und Theater zu entwickeln, müssen andere Erklärungszusammenhänge für die bestehende Affinität angesteuert werden. Ernst verweist im bereits zitierten Text auf einen entsprechenden Zusammenhang, wenn er schreibt, Theater sei “zugleich eine kulturtechnische Einübung der Veräußerlichung der Schrift, die mit ihrer Verinnerlichung als Stimme der Seele einherging” (hier). Hier scheint eine Funktion von Theater auf, die sich weniger auf es als Medium der Reflexion per se, als vielmehr auf eine Konstellation von Text und Stimme im Theater zu einem spezifischen historischen Moment bezieht. Es geht um eine Weise des Umgehens mit Text, die Jesper Svenbro (Jesper Svenbro. Phrasikleia: An anthropology of reading in Ancient Greece, 1988/1993, hier) herausgearbeitet hat. Im Dispositiv Theater geht es seiner Erkenntnis nach nämlich um eine Umstellung von lautem auf leises Lesen, wenn er ausführt, so Johann-Heinrich Königshausen:
“Der primäre Daseinsgrund der Schrift in der griechischen Antike ist es, so Jesper Svenbro, nicht Laute zu repräsentieren, sondern Laute hervorzubringen. Wer liest, laut liest, teilt in der Rede mit, z.B. den Ruhm Achills an die Zuhörer. Der Schriftsteller also bedient sich des Lesers als eines Instrumentes, eines mit Stimme begabten Instrumentes zur Weitergabe und Verteilung des im Text verborgenen Gehaltes.”
Das Theater setzt an dieser Stelle ein, so Svenbro, nach Königshausen:
“Der professionelle Leser, der also den Text auswendig lernt und vor vielen laut austeilt, dieses große Instrument der Kundgabe, wird im 5. Jh. der Schauspieler auf der Bühne. Das Theater eröffnet so nach Svenbro eine neue Haltung gegenüber dem Geschriebenen: die Möglichkeit des ‘stillen Lesens’: auf der Bühne die ‘Buchstaben, die singen’. Die Dramendichter schreiben also den Text in den Geist der Schauspieler, der ein Schriftraum ist. Die Bühne ist so ein Schriftraum, der sich selbst laut lesen kann.
Wenn sich das Theater so in das Buch interiorisiert, wird beim Leser eben dessen Geist als Bühne benutzt, auf der der Schriftsteller ein Drama aufführt mit Texten, die sich dem Leser selbst sagen/singen. Das stille Lesen folgt dem Text, der Leser ist ein Sklave des Textes, ist ‘unfrei’.”
Theater wäre in diesem Moment der Geschichte mithin als eine Kulturtechnik zu verstehen, die als epistemischer Apparat Lesen und Schreiben flankiert. Es ist nicht ein bestimmtes, reflexives Denken, sondern es erzeugt dieses erst. Von diesem Beispiel ausgehend kann die zeitgenössische Verknüpfung von Theorie und Praxis untersucht werden.
Subjekt kommt – Subjekt geht
Eine entsprechende Thesenbildung geht vom Topos des Theaters als Kulturtechnik für das Performen von Medien aus. In diesem Kontext könnte nun die Performativierung des Performativen seit den 1990er Jahren von besonderem Interesse sein. Denn diese erscheint als zeitgenössische Strategie mit einer medialen Lage umzugehen, die sich vor allem aus dem Verlust von Kontrolle technischer Umwelten sowie von anthropologischer Relevanz in diesen konstituiert. In der Antike nahmen es die Schauspieler auf sich, so nach Svenbro, zum Medium des Autors zu werden und diesen zugleich zum Schweigen zu bringen. Peter Geble schreibt:
[…] der Leser wurde als Sprachrohr des Schreibers, als Garant seines Nachruhms und damit als eine ebenso umworbene wie verachtete Gestalt angesehen. Dieses heute einigermaßen befremdende Verständnis der Schreiber-Leser-Beziehung orientierte sich in aller Drastik – so Svenbros These – an der päderastischen Beziehung, der Knabenliebe: mit allen nur denkbaren Mitteln der Verführung und Überwältigung mußte der Leser dazu gebracht werden, das Geschriebene zu ‘vokalisieren’. Erst die Erfahrung des tragischen Agons, von Stücken also, die von Schauspielern vor schweigenden Zuschauern vorgetragen wurden, scheint dann das stille Lesen, die Verinnerlichung der Stimme und damit eine erste Distanzierung ermöglicht zu haben.
Derzeit setzen sich die Spieler_innen dagegen unklaren Rollen- und Sinnverhältnissen aus, verlieren Identitäten, Zuständigkeiten von Speziesgrenzen und Subjekthaftigkeit. Sie sprechen zudem, so im Theater mit Theorie, fremde Denk- statt Figurentexte aus und reden erst gar nicht mehr miteinander. Sie könnten, so die These, in Tradierung er antiken Stellvertretung die mediale Überwältigung auf sich nehmen, um endlich das vom stillen Lesen erfundene Subjekt (Derrick de Kerckhove 1995) zu überwinden und einer unter vielen Akteuren zu werden (Wolfgang Ernst 2009). Die Performativierung des Performativen sowie das Theater mit Theorie hätten mithin einen entscheidenden Anteil an einer digitalen Kultur, die sich nicht mehr für Menschen, sondern vor allem für Daten interessiert und die im Neoliberalen selbst beherrschen.
Entscheidend ist, das nicht nur das Subjekt verabschiedet, sondern auch ein neues Modell für eine Form distribuierter Selbst-losigkeit entworfen wird, die an die Stelle des Subjektes tritt. Diesen Zusammenhang zu verstehen, ist noch einmal auf den Verabschiedung des Subjektes im Performativitätsdiskurs zwischen den 1970er–1990er Jahren, insbesondere auf die mit ihr aufkommende Bejubelung von Handlungsagenturen zu schauen.
Performativität und das Performative sind keine a-historischen Begriffe. Dass es in einer bestimmten Weise verstanden werden müsse, nämlich im Sinne der iterativen und transformierenden Kraft der Aus- und Aufführung von Handlungen, ist eine Erfindung des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Die Ermächtigung des Performativen geht zurück auf den so genannten performative turn (Malte Pfeiffer). Mit ihm wurde die Konstitution von Kultur von einem Primat der Texte auf die Aus- und Aufführung performativer Akte umgestellt. Diese Sicht gründete, es wurde schon erwähnt, auf der Sprechakttheorie von John Langshaw Austin (PDF, John Langshaw Austin 1955/62), die besagt, dass mit Worten gehandelt werden könne; so auch der englische Titel: “How to do things with words” (PDF, John Langshaw Austin). Dies geschähe etwa, wenn ein Priester ein Paar zu Mann und Frau erkläre. Darin zeigt sich auch, dass diese Sprechakte nur durch einen konventionalisierten und normierten Kontext wirksam werden.
Eine grundlegende Frage in der Auseinandersetzung mit Sprechakten und Performativität ist nun, welchen Status ein Subjekt einnimmt. Ist es als ein intentionales und identitäres zu denken, wie es Austin und letztlich auch die Theaterwissenschaft vorschlagen? Oder ist es vielmehr mit Jacques Derrida (Gerd Poselt) als Effekt der Sprechakte sowie von deren Aus- und Aufführung zu verstehen.
An dieser Sichtweise setzen auch feministische Diskurse an. Paradigmatisch ist die theoretische Rahmung von Judith Butler (Melanie Schmidt). Sie legt mit der Unterscheidung von Geschlecht und Gender nahe, dass Geschlechtszuweisungen nicht biologisch seien, sondern kulturell eingeschrieben. Diese Einschreibungen würden sich in der Ausführung von wiederholbaren Handlungen und Sprechakten vollziehen. Gerade in deren Wiederholung läge aber auch das subversive Potenzial des Performativen als Wirklichkeiten und Subjekte erst erzeugender Vorgang, denn es beinhalte eine Verschiebung in der Wiederholung, die zum Einfallstor von Resignifikationen werden könne.
Das heißt, das Performative und Performativität werden zu einer eigenständigen kulturellen Größe, die als Kraft gleichsam in die Geschicke von Gesellschaft, Politik und Ökonomie eingreift. Dies geschieht, ohne dass Institutionen oder Subjekte darüber Kontrolle ausüben könnten. Es entsteht vielmehr ein magisches Konzept der Praxeologie, des Aus- und Aufführens von Handlungen, das unabhängig von allen anthropologischen und technischen Bedingungen wirkt und wirksam ist. Performativität wird mithin selbst zum Supermedium, das im Vollzug von Akten oder der Nutzung von Medien, Subjekte und Wirklichkeit erst hervorbringt und diese zugleich ob der unberechenbaren und nicht kontrollierbaren Macht des Vollzugs immer schon durch sich ereignende Verschiebungen in der Wiederholung, mithin durch Iterabilität (Gerd Posselt) unsicher, prekär und porös werden lässt.
Von der performativen Konstitution des Subjektes ist es nur ein kleiner Schritt zum post-anthropologischen Modell der Handlungsagenturen (PDF, Bruno Latour 1996), in denen der Mensch keine besondere Rolle mehr spielen soll. Denn die Wende, dass Dinge und Performance eine Eigenmächtigkeit haben und menschliches Handeln der Intentionalität enthoben ist, erfordert zugleich eine Re-Modellierung von Handlungsfähigkeit, die u. a. über eine Revision von Medialität hergestellt wird. Es kommt zu einer Umstellung auf eine performative Praxeologie (PDF, Andreas Reckwitz 2003), in der das kulturelle Apriori der Medien aufgehoben wird zugunsten von Handlungen und Handlungskonstellationen, die sie auslösen. Entscheidend dafür ist die Umdeutung von Medialität, die sich im Zuge der Performativierung des Performativen vollzieht. Medien erzwingen gleichsam performative Akte und konfigurieren diese, denn so Sybille Krämer:
“Überdies sind uns Geist, Ideen, abstrakte Gegenstände, Formen immer nur zugänglich in Gestalt von Inkorporationen. Medien bilden die historische Grammatik des Performativen: Sie sind immer Medien der Verkörperung bzw. der Inkorporation. Performativität ist daher als Medialität zu rekonstruieren.”
Es ergibt sich ein unüberwindbares und verstörendes Wechselverhältnis von Medien und Performances etwa, wenn ein Text eine Idee trägt, in diese aber ob seiner Medialität interveniert und, von einer Stimme vorgetragen, wiederum von dieser modifiziert wird, da deren Medialität dazwischenkommt. Die Entfesselung des Performativen ist also ohne die des Medialen nicht zu haben, wodurch Subjekte und Intentionalität doppelt in weite Ferne rücken.
Diese Modifizierungen und Umwälzungen sind Voraussetzung dafür, dass für den Menschen eine neue Rolle erfunden wird. Denn mit der Performativierung der Performativen wie des Medialen bilden Mensch und technische Umwelt eine Handlungsagentur. Umwelten und Dinge lösen dabei zwar Handlungen aus, aber sie dominieren nicht, sondern von Interesse sind nunmehr die Handlungs-Gemeinschaften in Operationsketten, in die die Beteiligten verwickelt werden. Damit erhält Mensch letztlich nach den Jahrzehnten der technischen Apriorizität (PDF, Frank Hartmann 2008), die ihm zur Prothese der Technik machte, eine, wenn auch verteilte, Handlungsmacht zurück und damit eine zumindest zeitweise adressierbare und benennbare Position.
Diese Umwälzung sowie das Zusammenspiel (Johanne Mohs 2014) von Performativitätstheorien, performativer Medientheorie und Theorien zu Handlungsagenturen (von der Akteurnetzwerktheorie bis zu Techno-Ökologien) ist noch nicht bedacht und aufgearbeitet worden. Es wäre allerdings an der Zeit dies zu tun, denn in dieser Gemengelage gelingt es erst, zum Guten wie zum Schlechten, eine gründliche Umstellung der Medienanthropologie wie der Ökonomie zu bewerkstelligen. Es wird dabei ein weitreichendes Feld abgedeckt, so dass es gleichsam kein Entfliehen mehr gibt. In diesem Netz aus Überschneidungen und Wechselwirkungen korrespondiert (1) die Performativierung von Existenz und Kommunikation mit dem (2) Aufgehen des Menschen in operativen Handlungsketten sowie (3) mit dem techno-ökologischen Schwingen und Affiziert-Werden, um schließlich (4) in eine post-anthropozäne (Benjamin Bratton) Haltung und Epistemologie fließen zu können, in der Mensch, Welt und Ökonomie aus der Sicht von anderen Spezies, synthetischen Erscheinungen und planetarischen Ästhetiken noch einmal neu gedacht werden oder auch abgeschafft werden könnte. Diese diskursive Gemengelage ist zugleich eine Option des Um-Denkens wie eine der Beschwichtigung der Tatsache, das längst eine umfängliche Industrialisierung der menschlichen Datenlieferanten statthat, für die nicht mehr Singularitäten in die Pflicht genommen werden können, sondern eigendynamische Infrastrukturen, und von der Mensch mit Gadgets abgelenkt und bei Laune gehalten wird.
Die neuen, theorielastigen Performances könnten nun in diesem Kontext die Funktion haben, den Abschied vom Subjekt zu gewährleisten und die entstehende Leerstelle mit dem Modell der Handlungsagenturen zu füllen und die Ex-Subjekte in diese sowie schließlich in ein post-anthropozänes Universum zu überführen. Das Performen von Theorie ist dazu besonders geeignet, weil es eine Entmenschlichung von Theorie und Medien ermöglicht, etwa im Sprechen und Spielen von Texten. Damit wird das, was “Mensch” bisher ausmachen sollte, Denken, Vernunft, Theoriebildung, an Performances sowie deren Medialität abgetreten. Ein Innen der Spieler_innen wird dabei selbstredend entleert, um lustvolle und freudvolle Handlungskettenkaskaden zu ermöglichen.
So wie die Beförderung des stillen Lesens Aufgabe des antiken Theaters war, so obliegt es ihm nunmehr, im Wechselspiel von Rolle, Text, Theorie, Bewegung und Zuschauer_innen, Handlungsagenturen aufzubauen und zu erproben, die man vor allem lustvoll betrachtet ob ihrer Operativität, denen man aber nicht mehr mit Modellen von Sinnhaftigkeit, Repräsentation oder Einfühlung folgt. Im Fokus stehen nunmehr Handlungsanweisungen und operative Verkettungen.
Es lässt sich zusammenfassen, dass die Verhandlung der Beziehungsweisen von Theater und Theorie eine lange Tradition hat, die je eine andere Gestalt annimmt. Geht es z. B. in Fortsetzung der antiken “Theoria” um die Nutzung von Theater als Theorie, so steht derzeit Theater mit Theorie im Fokus. Wie gesehen, wurde in der medienwissenschaftlichen Forschung (Vgl. exemplarisch Wolfgang Ernst sowie Sybille Krämer) gezeigt, dass sich zur Nähe zur Theorie im Theater die zu Medialität gesellt. Deshalb kann dieser Phänomenbereich als Kulturtechnik des Umgangs mit Medien, insbesondere der Performativierung von Medialität angesehen werden. Diese Kulturtechnik wird dadurch nötig, dass Medien oder Umwelten, so u. a. Sybille Krämer, inkorporiert und performt werden müssen, kommen sie mit Menschen zusammen. In diesen Performances und Performativierungen werden Medien nicht einfach angewandt und aus- und aufgeführt, sondern vielmehr in einer Gebrauchsgeschichte von Medien erst konstituiert, wie sich an der Erfindung des leisen Lesens zeigte.
Diese Gebrauchsgeschichte hat darüber hinaus zwei weitere Funktionen. Erstens geht es um das Prinzip der Stellvertretung. So spricht der Schauspieler in der Antike Texte stellvertretend laut, damit andere von diesem entlastet werden und die Kulturtechnik des leisen Lesens ausüben können. Zeitgenössische Performer_innen übernehmen dagegen gerade im Kontext der Verbindung von Theater und Theorie stellvertretend die Aufgabe, sich zu entselbsten. Dieser Vorgang ist allerdings hochgradig ambivalent, da die exemplarische Entselbstung der Akteur_innen auf der Seite der Zuschauer_innen der Hervorbringung eines illusionären Selbst dient. Denn These ist, dass die im Theater mit Theorie erwirkten Handlungs-Gemeinschaften ein selbst-loses Selbst hervorbringen, um von der digital bedingten Selbst-losigkeit abzulenken. Theater mit Theorie ist mithin im besten Sinne Illusionstheater für eine parallele Welt operativer Handlungsagenturen.
Die zweite Funktion der performativen, aufgeführten Gebrauchsgeschichte liegt in der Erprobung von Kontrolle. Denn Theater setzt sich den Performances mit Medien in einer Weise aus, in der Distanzierung und Involvierung in ein Wechselverhältnis treten. Indem es zur Inkorporation kommt, setzen sich die Akteur_innen der Überwältigung aus und entwerfen zugleich Möglichkeiten, diese zu regulieren. Diese konstituieren sich zum einen aus der Wiederholung von Handlungen, die zwar iterativ ist, zugleich aber einen Bezugsrahmen für Überprüfungen, Vergleiche und Bewertungen schafft. Dadurch, dass traditionell Theorie und Medien in Theater verknüpft sind, steht Theater zum anderen für die Theoretisierung von Medialität und damit für den Versuch, Kontrolle über diese auszuüben. Es geht mithin in je anderer Form darum, das Performative und Mediale, d. h. die Aus- und Aufführung mit Körpern zugleich zu entfesseln und zu bändigen. Performative Inkorporation und Gebrauchsgeschichte können mithin als eine Kulturtechnik gelten, mit der Mensch mit seiner medialen Konstitution umgeht.
Es wäre vor diesem Hintergrund eine Geschichte der Beziehung von Theater und Theorie zu schreiben, die den Wandel von technologischen Bedingungen wie von Diskursen und Modellierung des Performativen untersucht.
Die genannten Aspekte und Funktionen einer Gebrauchsgeschichte gilt es bei Versuchen mit Theorie-/Theater zu beachten, denn mit den Performances und Performativierungen entstehen zugleich deren gouvernementalen Effekte. So bringt die Ermöglichung des leisen Lesens durch die performende Stellvertretung das innere Subjekt vorher. Die vorgeahmte Ent-Selbstung erzeugt sich selbst genügende, illusionäre Selbste.
Bevor die Inszenierung von “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” noch einmal aufgenommen und mit Bezugnahme auf die skizzierten Versatzstücke einer Theorie der Verbindung von Theater und Theorie betrachtet wird, soll anhand des Bandes “Theorie und Theater” (Hg. Mascha Vollhardt, Astrid Hackel, Theorie und Theater: Zum Verhältnis von wissenschaftlichem Diskurs und theatraler Praxis, Berlin 2014) eine Typologie möglicher Bezugsweisen von Theater und Theorie erstellt werden. Diese hat zugleich die Aufgabe, die hier entworfene theoretische Annäherung an die Verbindung von Theater und Theorie mit Beispielen aus der zeitgenössischen Theaterpraxis anzureichern und diese mit der Theoretisierung abzugleichen. Es wird vor allem darum gehen, die Art der zeitgenössischen Performativierung in der Ambivalenz von Ent-Selbstung und illusionären Selbst-Werdung zu spezifizieren.
Mit der Typologie entsteht ein Feld, das von der direkten Integration von theoretischen Textfragmenten, wie bei Pollesch (Vollhardt, Bergmann, Czirak), über eine dem Theater eigene, theoretisch auslegbare Reflexionsleistung (Czirak), bis hin zu performativen Bezugnahmen auf theoretische Modelle reicht, die in wissenschaftlichen Texten entworfen werden (Hackel). Die Typologie wird nach Weisen der Bezugnahme geordnet.
Unvereinbarkeiten. Ironie und Zitat
Inwiefern Theater ein eigenes theoretisches Potenzial hat, lässt sich aus dem Aufsatz von Adam Czirak: “Falsche Freunde. Von der Unversöhnbarkeit von Theater und Theorie” (S. 7–35) aus dem genannten Band ableiten. Czirak geht dabei von einer produktiven, da epistemologisch wirksamen Unvereinbarkeit von Theater und Theorie aus. Denn es bestehe eine grundsätzliche Differenz zwischen szenischem Zeigen und geistigem Reflektieren, womit die konstitutive Unsicherheit von medialer Vermittlung sowie das Moment des Nicht-Theoretisierbaren als Merkmal und Bedeutung der Verbindung von Theater und Theorie stark gemacht werden. Diese kämen durch ästhetische Mittel zustande, etwa der Ironie, wenn sie richtig verstanden wird, so Czirak:
“Nimmt man an, die Ironie wäre ein Kunstmittel und somit in der Rede identifizierbar, wüsste man auch entsprechend, wann der Autor das Gegenteil des Gemeinten predigt bzw. wann er genau das Gemeinte sagt. Die Reduktion der Ironie auf einen Kunstgriff suggeriert, dass auch jene Sprachwirkungen kontrollier- und rationalisierbar wären, die Schlegel in seinen Ausführungen Über die Unverständlichkeit und de Man in seinem Konzept der Rhetorizität als unauslotbar und gefährlich gedeutet haben.”
Nach Czirak geht es, so ließe sich zuspitzen, bei der Begegnung von Theater und Text vor allem darum, Sprache in ihrer Medialität zu reflektieren, die eben nicht zur Repräsentation taugt. Sie konstituiert sich vielmehr aus einer Eigendynamik sowie aus Verschiebungen, was ihre Unkontrollierbarkeit bedingt, was auch eine neue Sicht auf Theater ermöglicht, wenn Czirak schreibt:
“Einerseits läuft die Unkontrollierbarkeit der Ironie auf die Erosion von Theaterkonventionen rollenbedingten oder ichidentischen Sprechens und Zeigens hinaus. Andererseits tangieren die Verwirrungen auch die theoretische Anschlussfähigkeit an diese Inszenierung: Bedenkt man, wie häufig theatrale Kommunikation assoziiert wird mit Responsivität, Dialogizität und Wechselseitigkeit zwischen Akteur_innen und Zu-schauer_innen […]”
Theater wird so im Sprechen ohne Urheber sowie ob der Un-Möglichkeit zur Repräsentation einer vorgängigen Wirklichkeit zu einer Reflexion über die “Grenzen des Logischen und Verlässlichen” (S. 13). Ein weiteres ästhetisches Mittel, diese Reflexionen und Erkenntnisse zu vermitteln ist, neben der Ironie, das Zitat. Czirak geht es, so folgt daraus, um ein “Theater der Dekonstruktion” (S. 30), das tradierte Vorstellungen von Kommunikation im Theater unterbrechen und außer Kraft setzen, wenn er weiter ausführt:
“Worte, die in der Linguistik als falsche Freunde bezeichnet werden und in zeitgenössischen Inszenierungen durch schwindelerregende Zitationsverfahren zum Vorschein kommen […], dann wird zwar menschliche ‘Kommunikation als Kommunikation von Bewußtsein oder von Anwesenheit […]’ (Derrida 1999, S. 334) unterbrochen, aber durch diese Unterbrechung binden faux amis auch, sie stiften Bezüge und motivieren neue Strategien der Sinnproduktion. Falsche Freunde verunsichern in der Tat, indem sie ein automatisiertes Verstehen aussetzen und eine hermeneutische Sinnübertragung in Frage stellen.”
Es geht mithin um eine epistemische Übung zu Sinnstiftung und Medialität, die das Theater gleichsam als Theorie leisten kann:
“Folgt man dieser Logik, dann sind falsche Freunde als dramaturgische Einheiten zu begreifen, die die Sinnbildung sowohl in Gang zu setzen als auch in Gefahr zu bringen vermögen und dementsprechend nicht an ihrer epistemologischen Zuverlässigkeit zu messen sind. Geraten Zitate in Misskredit, dann machen sie gerade auf die Unmöglichkeit einer trennscharfen Differenzierung zwischen Sagen und Gesagtem, Repräsentierendem und Repräsentiertem, ja einer Unterscheidbarkeit von wahren und falschen Dimensionen der Freundschaft aufmerksam. Kurzum: Falsche Freunde der Zuschauer_innen führen aus der Ökonomie eines konsolidierten Sinntransfers hinaus und leiten in die Sphäre des Politischen, überschreiten sie doch die Ordnung des Nützlichen, in der alles ‘aus der Hand in die Hand’ (Derrida 2000, S. 274) spielt.”
Es gälte, so Czirak, Theater und Theorie als falsche Freunde aufrechtzuerhalten, deren Potenzial gerade in der unversöhnbaren Spannung liegt.
Diese Haltung zur Verbindung von Theater und Theorie ist, wie ersichtlich wird, von einer bestimmten Sicht auf die Medialität von Sprache bedingt, für die prominent Jacques Derrida steht. Ausgehend vom an dieser Stelle vertretenen Ansatz wäre diese Auslegung allerdings einer technikgeschichtlichen Analyse zu unterziehen, wie sie im Kapitel zum Performativitätsdiskurs angedeutet wurde. Demnach wäre zu vermerken, dass das zitierende und ironisierende, dekonstruktive Theater einen großen Anteil an der Austreibung des Subjektes und davon ausgehend an seiner Agenturisierung in operativen Handlungsketten hat. Es kann zwar nicht hinter die Derrida’sche Sprachkritik zurückgegangen werden, es soll aber auf deren Produktivität aufmerksam gemacht und herausgestellt werden, dass die für sie konstitutiven Mittel Zitat und Ironie gegebenenfalls auch jenseits von einer Ontologisierung des Performativitätsdiskurses eingesetzt werden können.
Widerstand gegen Theorie durch Hypostasie der Nachahmung
Astrid Hackels Aufsatz: “Disco und Diskurs: Die performing society als Denkfigur zwischen Kapitalismuskritik und Performancekunst (Boyan Manchev & Willy Prager)” (S. 37 – 51) steht für die Kategorie der Auseinandersetzung mit einem Diskurs, der selbst nicht in einer Inszenierung erscheinen muss, in dessen Kontext sie aber entstand und auf den sie Bezug nimmt. So geschah es in der Produktion “Transformability” (2012) von Willy Prager, die sich mit einem theoretischen Text von Boyan Manchev auseinandersetzte. In ihrem Text geht Astrid Hackel nun der Frage nach, wie in der Produktion performend Kritik an der neo-kapitalistischen Gesellschaft geübt werden könnte, ohne selbst deren Teil zu sein. Manchev konstatiert nämlich in seinem Text, dass in der neoliberalen Ökonomie gerade Tanz und Performance ob ihrer Verwendung ungeheuer flexibler Körper dieser zuarbeiten könnten (S. 39). Damit wird nahegelegt, dass Widerstand gegen die kritisierten Verhältnisse immer im Vokabular des Kritisierten ausgedrückt würden (S. 39).
Die Performer_innen verfügen nun aber über eine ästhetische Methode, um der Vereinnahmung zu entgehen, die auch für die hier verhandelte Produktion “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” von größtem Interesse ist. Denn sie nutzen eine “unproduktive Verausgabung als Widerstand” (S. 48). Astrid Hackel fasst zusammen:
“Erst die unproduktive Verausgabung verdeutlicht, dass die subversiven Momente von Anfang an als versteckte Effekte in der Performance angelegt sind: Vom ersten Sprung an verunklären die Performer_innen ihre äußere Fassung, indem sie zwischen zwei unmöglichen Positionen beständig hin und her springen: Während sie selbst den Blick zum Publikum suchen, lassen sie sich in ihrer Unschärfe im Gegenzug kaum fixieren. […] Indem sich die Körper im exzessiven Wiederholen der Sprünge […] zurückmelden, unterstreichen sie diesen äußeren Formverlust: Identität basiert hier auf der Zerrüttung des Körpers […]. Es geht um transformierenden Potenziale der ‘Ent-Staltung’ […] und um das Recht auf nutzlose Verausgabung. Das mag angesichts der körperlichen Entkräftung nicht gerade eine gesunde Form des Widerstands darstellen, spiegelt aber die vielfältigen Praktiken der (Selbst-)ausbeutung vieler freischaffender Künstler_innen und denkt sie weiter bis an einen potenziellen Punkt, an dem (Selbst-)ausbeutung umschlagen muss. Irgendwann früher oder später stoßen die Perfomer_innen in Transformability an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Artifizierbarkeit; das ist kein plötzlicher, sondern ein steter Prozess der Ermüdung, der Ermattung, der zunehmenden Verweigerung: Sie können gar nicht anders als früher oder später zu streiken, […].”
Von besonderem Interesse ist, dass auch in der von Hackel beschriebenen Produktion, wie in “John Gabriel Borkman und andere anti_kapitalistische Held_innen”, Verausgabung als Figur des Widerstands gegen neoliberale Ökonomien stark gemacht und erprobt wird. Die Verhaltensweisen bleiben allerdings nicht beim Destruktiven stehen, sondern sie erschließen neue Verhaltensweisen, zu denen Hackel schreibt:
“[…] sie (die Akteur_innen, M. L.) eigenen sich diesen Ablauf an und wiederholen ihn solange, bis sich die Aussage in dieser Wiederholung selbst verändert. Das Nachgeahmte wird im Vorgang der exemplarischen Konstituierung in Echtzeit als inhaltsleer decodiert und entwertet. […] Das stete Nachahmen eines programmatisch außerhalb der Bühne situierten Musters das in ebenso steten Praktiken des Vormachens besteht, lässt in diesem Sinn von Willy Pragers Performance aus über den Umweg der (verdeckten) Imitation neue Formen der Handlungsfähigkeit erahnen.”
Im Exzess der Nachahmung werden mithin Reflexion sowie eine neue Handlungsfähigkeit möglich, wobei letztere nicht aus der vom Performativitätsdiskurs bekannten Verschiebung und Resignifikation konstituiert. Vielmehr wird Performen selbst als bis zur Erschöpfung führende körperliche Aktion stark gemacht als Option des Widerstandes.
Verschaltungen anlegen und performen
Wie René Pollesch in seinem Diskurstheater Theorie und Theater verbindet, beschreibt Franziska Bergmann in “Enacting Theory. Zur theatralen Rezeption humanwissenschaftlicher Diskurse bei René Pollesch am Beispiel von Das purpurne Muttermal” (S. 53–67). Sie analysiert, wie und mit welchen Effekten Pollesch Texte von Donna Haraway über Gender- und Speziesgrenzen mit Agambens Modell zu Ausnahmezuständen so verbindet, dass ein “Denkraum” (S. 60) entsteht.
“Mithilfe des Haraway’schen Entwurfs eines Mensch-Tier-Verhältnisses jenseits der anthropologischen Differenz wird in Caroline Peters Rede Agambens Argument gestützt, dass die Trennung zwischen den Spezies Mensch und Tier eine kontingente Setzung ist und dass es beim nackten Leben eigentlich um die Unterteilung in Körper geht, denen eine Seele zugesprochen und um Körper, denen die Seele abgesprochen wird.”
Auf diese Weise gelänge es Pollesch:
“[…] im Anschluss an Haraway (zu, M. L.) demonstrieren, dass sich Tierphilosophie bzw. Animal Studies und Gender-Theorie insofern in einen produktiven Dialog bringen lassen, als es beide Denkmodelle ermöglichen, subtile Machtkonstellationen offen zu legen, die auf der Differenz von unmarkiert-hegemonialem Eigenen und markiert-subalterm Anderen beruhen, einer Differenz also, welche sowohl das abendländische Mensch-Tier-Verhältnis als auch das Geschlechterverhältnis maßgeblich strukturiert.”
Bergmann fasst ihre Erkenntnisse zusammen:
“Anhand der gewählten Szenenbeispiele aus Das purpurne Muttermal wurde gezeigt, dass sich Polleschs theatrale Bearbeitung des Theoriematerials äußerst vielfältig gestaltet. Nutzt Pollesch das Theater einerseits als experimentellen Freiraum, in dem sich die abstrakten theoretische Modelle der Tierphilosophie von Donna Haraway in konkrete Situationen übersetzen und somit auch auf mögliche realweltliche Konsequenzen prüfen lassen, so etabliert Pollesch die Bühne zugleich als eine Art Denkraum, innerhalb dessen kontroverse Dialoge zwischen den Schauspieler_innen dazu dienen, verschiedene theoretische Positionen – etwa von Haraway oder Agamben – miteinander zu verschalten und weiter zu entwickeln.”
Hier stehen dramaturgische Gestaltungsweisen im Vordergrund, um die Beziehung von Theorie und Theater fruchtbar zu machen. Dies gelingt durch das Prinzip der wechselseitigen Ergänzung.
Sehhilfe und Denkschule
Mit dem Beitrag von Mascha Vollhardt zu Polleschs Diskurstheater wird dann allerdings noch einmal deutlich, welche Bedeutung Pollesch Verbindung von Theater und Theorie im hier verhandelten theoretischen Rahmen haben könnte. Es zeigt sich nämlich, dass und inwiefern das Diskurstheater im Kontext der Entsubjektivierung steht. Dies hängt aufs Engste mit dessen Status als Denkschule zusammen, als die Vollhardt Polleschs Schaffen in: “(Feministische) Theorie und Alltag. Theorie als theatrale Praxis in Sex. Nach Mae West und Die Welt zu Gast bei reichen Eltern von René Pollesch” (S. 69–84) exemplifiziert.
Theater mit theoretischen Texten würde, so Vollhardt, als “Sehhilfe” genutzt, um eingefahrene und mit Macht durchsetzte Denkmuster, Konstellationen und Verhältnisse zu denaturalisieren. Die Verbindung von Theorie und Performen wird dann zur Denkschulung, wenn die Dramaturgie einer Inszenierung eine bestimmte Art des Denkens ist, wie Mascha Vollhardt schreibt:
“Das ambivalente politische (Nicht-)Subjekt, das versucht, mit der ‚Sehhilfe’ der Theorie seinen Alltag zu bearbeiten, wird als gleichzeitig existierendes und immer schon scheiterndes im Text und auf der Bühne performativ hergestellt. Die Reflexion der eigenen Position mithilfe von Konzepten aus der feministischen Theorie […] wird als unablässige Arbeit gezeigt. Pollesch stellt diese Arbeit aber nicht nur dar, er stelle die Theorie als eine Art Alltagspraxis performativ her, womit er sich innerhalb der feministischen Tradition befindet, die die Verbindung von Theorie und Alltag in der Praxis anstrebt. Insofern leistet er eine Verbindung […] auch von Theorie und theatraler Praxis – zur Theorie als theatraler Praxis.”
Mit Bezug auf den in diesem Text skizzierten theoretischen Rahmen kann vermutet werden, dass Pollesch ein bestimmtes Denken mit dramaturgischen und ästhetischen Mittel fördern will, das einmal mehr in Kontext des Performativitätsdiskurses steht. Dies gilt insofern, als Gendertheorien, wie bereits angeführt, sich aus der Performativierung des Performativen konstituieren. Denn Geschlecht wird kulturell eingeschrieben und überformt. Gendertheorien haben in den Geisteswissenschaften eine hohen Stellenwert im Sinne des “Queering” von vorgängigen Haltungen und Einstellungen. Als solche sind die Theorien prädestiniert zur Bewältigung des Alltags, wie Pollesch selbst sagt, da sie helfen, Machtmechanismen zu entdecken und Dinge anders zu denken. Diese kritisch-reflexiven Haltungen sind von größter Wichtigkeit, auch und gerade in digitalen Kulturen, denen nachgesagt wird, sie würden Kritik unmöglich machen. Es ist allerdings auch hier zu bedenken, dass die genderkritische Theoriebildung mit einem technikgeschichtlichen Kontext verbunden ist, in dem sie ihre diskursive Produktivität entfaltet. Selbst-lose Individuen und operative Handlungsketten generieren eine Form der Gouvernementalität, die auf Erschöpfung durch Performances gründet.
Fazit. Ent-Selbstung für illusionäre Selbst-Werdung
Es gilt nun, die Typologie auszuwerten und dabei das Wechselspiel von Entselbstung und illusionärer Selbst-Werdung zu spezifizieren.
In den beschriebenen Produktionen ist die Aufgabe eines Subjektes sowie eines verbesonderten Status des Anthropologischen gleichsam Mainstream. An deren Stelle treten im Theater mit bzw. als Theorie eine Lust an Denken sowie an Verunsicherung. In dieser Atmosphäre werden die Performativierung von Existenz, Ent-Selbstung sowie Agenturisierung zu einem geradezu freudvollen Vorgang. Denn durch das Performen von Theorie wird dieses zwar zum einen verkörpert, gleichsam am Körper getestet. Zugleich aber wird es zum anderen zu einem reinen Gedankenspiel, zu einer epistemologischen Übung.
Zugleich entsteht durch das Denken über die Selbst-losen auf der Bühne die Illusion, dass man selbst ein Selbst haben könnte, da man ja immerhin Unterschiedliches zusammendenkt. Dieses Selbst ist allerdings deshalb eine Illusion, weil es nur zum Zwecke der Gedankenspiele existiert. Je mehr man sich mit Denken amüsiert und mittut, desto mehr entsteht ein Selbst und umso schneller versinkt es wieder, da es alleine um das Durchspielen von Optionen geht, die in nichts münden.
Werden diese Vorgänge vor dem Hintergrund digitaler Kulturen betrachtet, dann ist zu beachten, dass diese nicht mehr gänzlich für menschliche Nutzer_innen einsehbar, geschweige denn kontrollierbar sind. Vielmehr kommt es zu einer Ökonomie der Daten, die vor allem vom Geheimnis lebt. Werden nun in dieser technologischen Lage Theorie des Performativen sowie der Handlungsagenturen im Theater performt, die einer Ent-Täuschung des Anthropologischen sowie des Singulären entsprechen, dann könnte dieses als Bühne der digitalen Heimatlosen Sinn machen. Leben wird zu einer Denkoperation, die sich selbstbezüglich immer weiter ausdifferenzieren kann. Dabei geht es vor allem um eine große Ablenkung von neuen Status des Menschen als Datengeber.
Diese perspektivische Option sollte bei Theater und Theorie immer mit bedachte werden.
Auch im Theorietheater “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” wurden theoretische Texte in szenischen Konstellationen aufgeführt. Die Performativierung von Theorie sollte allerdings nicht eine bestimmte theoretische Einstellung und Haltung favorisieren, sondern im Gegensatz zu den soeben skizzierten Versuchen dem Anliegen folgen, die Konstruiertheit sowie die gouvernementalen Aspekte von Theorien sowie von Wissen zu zeigen. Dieses Anliegen kann nun abschließend vor dem Hintergrund der hier entwickelten theoretischen Erfassung der Verbindung von Theater und Theorie im Hinblick darauf betrachtet werden, ob es gelingt, mit diesem Ansatz technikaffine Vereinnahmungen zu verhindern. Ins Zentrum rückt nun, dass performative und dekonstruktive Ansätze einen nicht reflektierten techno-logischen und gouvernementalen Kontext mitführen, der beachtet werden muss. Vor diesem Hintergrund scheint es angemessen, eine diskursanalytische Ästhetik stark zu machen.
Im Diskurstheater von René Pollesch sowie im dekonstruktivistischen performativen Denken, wie es Czirak beschreibt, sollte jeweils eine bestimmte Denkhaltung und theoretische Orientierung mit ästhetischen Mittel gleichsam erzwungen werden. Im Stück “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” wurde dagegen mit verschiedenen Mitteln versucht, ein Training für den Performativitäts- und Agenturisierungsdiskurs zu vermeiden. So wurde z. B. durch die Kritik am Neoliberalen die zu diesem geführte Theoriebildung angezweifelt und eine eigene Theoriebildung losgetreten. Es ging mithin um das Testen von Theorie statt sie als Gegebene hinzunehmen. Des Weiteren wurden in “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” Ironie und Zitat in einem diskursanalytischen Sinne eingesetzt, statt, wie Czirak, einer dekonstruktiven Ontologie zu folgen, mit der Ironie und Zitat auf die Eigendynamik von Sprache verweisen. Es geht mithin, im Unterschied zu Czirak nicht darum, eine Sicht auf Welt zu vermitteln, sondern einen Raum diskursanalytischer Ästhetik und Reflexion zu gestalten. Es wäre bei solchen Versuchen darauf zu achten, dass vor allem Ironie nicht das vermeintlich Gemeinte ex negativo vermitteln soll, da mit dieser Umgangsweise, wie Czirak sehr zurecht vermerkt, Sprache wiederum als Repräsentation einer ihr vorgängigen Wahrheit verstanden würde. Sie hätte vielmehr bei der Unvereinbarkeit von Text und Handlung anzusetzen, mit der erst ein Freiraum für Theoriebildung entstehen kann. Dieser stellte sich z. B. vor allem am schon genannten “Theorietisch 2” ein, bei dem neoliberale Haltungen und Fantasien affirmiert wurden, etwa Sprüche wie: “Es ist toll ausgenutzt zu werde, denn dann wird man zumindest gebraucht!”, oder “wo ist das Problem damit, sich ein Kind auszuleihen?” Mit diesen Merksätzen wurden Denkstürme ausgelöst, die eine eigene, nicht kontrollierbare Dynamik entfachten und ein Feld vor allem der Beobachtung des Denkens selbst sowie seiner Bedingungen und Konsequenzen eröffneten.
Auch ohne dem dekonstruktivistischen Diskurs zu folgen, ist die Verbindung von Theater und Theorie von größter Relevanz, da sie Theater in ein epistemisches Labor verwandeln können, das die Reflexion von Theorien ermöglicht sowie die Produktion von Wissen und Sinnstiftung kritisch reflektiert und offen hält. Dies zu ermöglichen erwies es sich in der Inszenierung von “John Gabriel Borkman und andere anti-kapitalistische Held_innen” als hilfreich, dass Stückvorlage und Theorie sich nicht direkt verknüpfen ließen, wie bereits ausgeführt wurde. Theorie und Theater lassen sich nicht aufeinander abbilden. Indem sie nebeneinander stehen blieben entstand ein Freiraum für Assoziationen.
Ein weiterer Aspekt ist schließlich, dass die Möglichkeiten des Performativen ob des Performativitätsdiskurses und dessen Produktivität mit Vorsicht einzusetzen sind. Statt also auf die transformativen Kräfte des Performativen sowie die Offenheit und Unvorhersehbarkeit von Performances zum Zwecke der Entsubjektivierung und Agenturisierung zu setzen, waren diese Effekte in eine diskursanalytische Ästhetik zu wenden. Dies geschah zum einen dadurch, dass Theorie performt wurde, um sie sich an materiell erlebbaren Situationen reiben zu lassen mit dem Ziel, ihre Tragfähigkeit zu testen sowie ihre Effekte herauszustellen. Es sollte dabei keine kohärente Theorie entstehen, sondern ein Nachdenken entfacht werden. Dies ist von Nöten, da jede theoretische Sicht eine eigene Weise der Einschreibung und Ausübung von Macht und Kontrolle mit sich führt.
Die Verbindung von Theater und Theorie, so der Vorschlag, könnte eine Möglichkeit sein, einen anhaltenden Prozess des Nach-Denkens und Über-Denkens entstehen zu lassen und dabei statt eine bestimmte Art des Denkens dieses selbst und seine Bedingungen und Wirkungen nachvollziehbar und erlebbar werden lassen. Zudem kann Theater mit Theorie als eine eigene Weise der Forschungsleistung im Performen betrachtet werden.